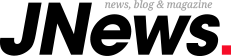Von Susan Bonath
Von Bus und Bahn über die Post bis zum Gesundheitswesen: Vieles, das zur öffentlichen Daseinsfürsorge zählt, funktioniert in Deutschland nicht mehr gut. Und das ist noch gelinde ausgedrückt. 36 Jahre nach dem Mauerfall hört man bei uns im Osten des Landes immer öfter Leute sagen: In der DDR, da lief das alles wenigstens. Als Ossi gerät man bei solchen Worten schnell in den Verdacht der “Demokratieverdrossenheit” – obwohl das vereinte Deutschland inzwischen fast so alt ist, wie die DDR nur werden konnte.
Wie “schlimm” es dort gewesen sei, kann man zum Jahrestag des Mauerfalls mal wieder rauf und runter in der gesamtdeutschen Presse lesen. Da lassen sich meist westdeutsche Autoren über Dinge aus, die sie vor allem aus der Propaganda kennen. Schlagzeilen machen sie mit den üblichen Themen, vom angeblichen “Zwangsdoping” bei Sportlern über Rührgeschichten von Republikflüchtlingen hin zu Mauertoten. Man kennt die Propaganda: Die Planwirtschaft war Teufelswerk und schuld daran, dass es nichts gab.
Dabei gibt es heute eine ganze Menge, was wir Ossis vermissen. Als ich 1988 in die heutige Börde-Kreisstadt Haldensleben bei Magdeburg mit rund 20.000 Einwohnern zog, hatten wir zum Beispiel ein Kino, zwei Freibäder für den Sommer und eine Schwimmhalle für den Winter. Übrig geblieben ist davon nur noch Letztere die wurde zwar aufgehübscht, ist aber längst unerschwinglich für ganz viele Familien.
Zum Glück, so denkt sich wohl die Stadt, gibt’s hier auch Reiche, die im Spaßbad unter sich sein können. Denn Haldensleben gilt als Speckgürtel zwischen Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg und der (nicht mehr schön anzusehenden) VW-Metropole Wolfsburg in Niedersachsen. “Hohe Tiere” mit Spitzengehältern, meistens aus dem Westen stammend und nun in die eine oder andere Richtung pendelnd, haben sich kleine Luxuseinfamilienhäuschen zugelegt. Ihre Siedlungen haben den Wald zurückgedrängt und ihre üppigen Geldbeutel die Mietpreise drastisch in die Höhe getrieben.
Früher hatten wir auch mal ein Krankenhaus mit allem Drum und Dran. Heute ist das Gebäude vollsaniert und hat einen Extraanbau bekommen. Es gehört jetzt dem Klinikkonzern Ameos. Der hat erst den Kreißsaal, dann die Kinderstation und dann das Labor weggespart. Das Essen liefert heute ein externer Billiganbieter – Vitamine: Fehlanzeige. Um als schwangere Frau in den Wehen oder mit einem schwer kranken Kind in eine passende Klinik zu gelangen, muss man heute über 30 Kilometer fahren. Kinder sind nun mal nicht lukrativ.
Als Kreisstadt haben wir auch einen Bahnhof. Früher fuhren dort viele Züge – nicht nur in Richtung Magdeburg und Oebisfelde, einer ehemaligen Grenzkleinstadt nahe Wolfsburg, sondern auch in viele kleine Orte. Die Dörfer sind längst abgeschnitten vom Zugverkehr, manche sogar von jeder Busverbindung. Und mit den jeweils 30-Minuten-Strecken in die eine oder andere Richtung läuft es auch nicht mehr so richtig. “Ich kann froh sein, wenn ich zweimal die Woche pünktlich oder überhaupt ankomme“, berichtete mir kürzlich die jugendliche Tochter einer Nachbarsfamilie, die nach Magdeburg zur Ausbildung fahren muss.
Ja, Zugausfälle ohne Ersatzverkehr sind hier die Regel. Manchmal erfährt man das erst fünf Minuten vor der erhofften Abfahrt im Internet. Einmal kann die Bahn ein Stellwerk nicht besetzen, ein anderes Mal ist ein Lokführer plötzlich erkrankt und die hier tätige Bahntochter namens “Start Mitteldeutschland” hat keinen Ersatz gefunden. Für das Bahnchaos muss man gar nicht mehr auf Schnee im Winter warten.
Bis vor kurzem gab es in Haldenslebens Innenstadt auch eine Post. Nun ist auch die seit Wochen dicht. Es habe Probleme mit dem externen Betreiber, einem Edeka-Markt, gegeben, an den das privatisierte Unternehmen seine hiesige Filiale ausgelagert hatte, vermeldete unsere Regionalzeitung Volksstimme. Pech für alle, die kein Auto haben: Die nächste Filiale befindet sich in einem abseits gelegenen Ortsteil, etwa fünf Kilometer von der Innenstadt entfernt. Für Senioren mit Rollator ist das eine Tagesreise.
Neulich hatten wir hier eine Havarie. Weil eine Leitung geplatzt war, mussten die Stadtwerke das Wasser für einen Teil meines Wohngebiets abstellen. Als ich das um die Mittagszeit bemerkte, rief ich das Unternehmen an. Man sagte mir den Grund, wisse aber nicht, wie lange das wohl dauere. So zog ich los und kaufte in weiser Voraussicht mehrere Sixpacks Wasserflaschen ein – für mich und einige Senioren.
Am Abend gab es immer noch kein Wasser und keine einzige Information von den Stadtwerken. Es kam, wie es kommen musste: Mieter unserer Genossenschaft kehrten von ihren Spätschichten zurück und standen unerwartet und verdutzt im Trockenen. Sie hatten Glück im Unglück, denn einige Nachbarn und ich verteilten an sie Wasserflaschen. Die Supermärkte schließen bei uns nämlich allesamt um 20 Uhr.
Am nächsten Tag – das Wasser war immer noch weg – kritisierte ich Vermieter und Stadtwerke wegen fehlender Information und Hilfe. “Leute, ihr könnt doch eure zahlenden Mitglieder nicht so hängen lassen”, sagte ich einem jungen Mann von der Genossenschaftsverwaltung und fügte an: “Vor 36 Jahren hätte es in solchen Fällen zumindest Hilfe gegeben.” Nur um mir dann eine Predigt über die Segnungen der glorreichen Freiheitsdemokratie anzuhören. Da hat die Propaganda wohl gewirkt, so dachte ich bei mir.
Erst am nächsten Abend sickerte die erste braune Brühe aus den Wasserhähnen. Ich ging los, um die Baustelle nahe eines Kinderspielplatzes zu begutachten – der einzige in unserem Wohngebiet, der nun halb gesperrt war. Früher, so erklärte mir eine alteingesessene Seniorin in der Nachbarschaft, gab es davon viele hier. Die Stadtwerke hatten eine externe Firma beauftragen müssen, um mehrere Bäume mit ihren Wurzeln auszuheben. Anders hätte man die Leitungen nicht erreichen können, hieß es auf Nachfrage.
Na ja, so eine Havarie passiert in den “besten Systemen”, auch früher in der DDR waren wir nicht gefeit davor. Spontan erinnerte ich mich an einen eindrücklichen Fall aus meiner frühen Kindheit in Magdeburg: den Schneewinter 1978/79. Direkt über Silvester fielen bei uns Strom und Heizung aus. An den Straßenseiten türmten sich meterhohe weiße Berge, die Räumfahrzeuge hinterlassen hatten. Die Fußwege waren wegen der Schneemassen nicht begehbar, und es rieselte immer weiter vom Himmel.
Männer mit Schippen schaufelten die Wege von den Hauseingängen zu den Straßen frei, damit die Leute aus der Tür kamen. Ein großes Auto folgte einem Räumfahrzeug, Leute stiegen aus, klingelten an Wohnungstüren und verteilten kostenlosen heißen Tee und warme Suppe aus der Gulaschkanone. Unsere Stadtteilgaststätte bot einen Gratis-Mittagstisch für alle an, die mangels Strom nicht selbst kochen konnten. Auch Kerzen für die Beleuchtung erhielt man dort. Ich bin sehr gespannt, wie das wohl heute laufen würde.
Ja, sicher, wir hatten vieles nicht. Beim Hausbau halfen oft nur gute Kontakte weiter, für ein Auto musste man sein Kind frühzeitig anmelden und manchmal stand man lange für bestimmte Klamotten oder die berühmten Bananen aus Kuba an. Apropos Klamotten: Dazu fällt mir eine (West-)Geschichte aus den frühen 2000ern ein. Es war Ende Dezember in Berlin, ich kam mit meinen Söhnen vom Flughafen aus wärmeren Gefilden zurück. Der Reißverschluss der Winterjacke meines Jüngsten war kaputtgegangen. Wir brauchten dringend eine neue für den Weg nach Hause. Nach drei abgeklapperten Läden hatten wir eine erstanden, die zwei Nummern zu groß war – aus Restbeständen, denn der Winterschlussverkauf war schon vorbei.
Immerhin gibt es heute bessere Häuser als damals in der DDR. Die sehen wirklich schöner aus und sind viel besser isoliert. Letztens ging ich die Straße entlang, in der ich 1988 meine erste Altbauwohnung bezogen hatte: knapp 40 Quadratmeter, 1,5 Zimmer, Küche, Dusche, Kohleofen für 26 Mark im Monat. Man musste im Winter viel heizen und im Herbst dafür die Kohlen in den Keller schleppen. Wir hatten in der kalten Jahreszeit Probleme mit Salpeter, der die feuchten Kellerwände emporstieg.
Das Haus steht noch. Es wurde privatisiert, die Wohnungen vermietet. Sie haben bunte Isolierplatten draufgeklebt, den Garten als Parkplatz zubetoniert und sogar Bäder mit Fliesen in die Wohnungen gebaut. Und dann sah ich es: Unten neben den Kellerfenstern kroch wie dereinst der Salpeter die Wände rauf, verkleisterte milchig weiß die rotbraune Farbe der Isolierplatten – obwohl es noch nicht mal sehr kalt war.
Da kam mir ein Gedanke: Das ist Kapitalismus. Für den schönen Schein füllen sie ihre glitzernden Schaufenster mit Waren, die schnell kaputtgehen. Sie pinseln alles Störende über, kleben Deko darauf und machen Wichtiges so teuer, dass sich das kaum noch einer leisten kann. Schließlich müssen die Profite für Wenige weiter sprudeln. Aber der Dreck unter den Fassaden hat sich vervielfacht.
Zum Glück für den Staat gibt’s für alles Privatisierte nicht mal eine Beschwerdestelle. Man kann sich ja ’ne andere Wohnung oder Klinik suchen, oder einfach ein Auto zulegen, wenn Bahn und Bus nicht mehr fahren. Wir wissen es ja aus den Medien: Planwirtschaft ist Teufelswerk, erst recht jene der DDR. Als würden Großkonzerne niemals planen. Natürlich tun sie das, nur blöderweise allein für ihre eigenen Renditen.

Wo man auch hinsieht: Die wertewestlichen Fassaden der einst von Altkanzler Helmut Kohl versprochenen “blühenden Landschaften” bröckeln an allen Ecken und Enden. Das konnte auch nicht anders kommen im kapitalistischen Krisenzyklus, in dem wir alle sparen, kürzertreten und ackern sollen, um die sporadisch schwächelnden Profitraten der Besitzenden wieder auf Vordermann zu bringen. Es bleibt zu hoffen, dass es irgendwann einmal vielen auffällt, dass es nur darum geht – und man das durchaus ändern könnte.
Mehr zum Thema – Fackelrituale und Lumpenpazifismus – Was hat die Feuertaufe der Litauen-Brigade zu bedeuten