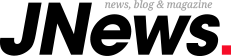von Dagmar Henn
(Teil 1 finden Sie hier.)
Eine Zeit ohne Zukunft
Die Ersetzung der Utopie durch die Dystopie erfolgte nicht zufällig. Der Wendepunkt liegt tatsächlich an jenem Moment Anfang der 1970er, als die Wachstumsphase von Automobil- und Elektroindustrie vorbei war und im gesamten Westen die Flucht in Spekulation und Rentenwirtschaft begann. Mit dem Wachstum (nicht, wie der Club of Rome behauptete, absolut, aber eben unter den Bedingungen der Kapitalverwertung) endete auch, in allen westlichen Kernländern mehr oder weniger gleichzeitig, jede Weiterentwicklung des Sozialstaats, und das neoliberale Elend begann.
Man könnte sagen, dem Kapitalismus waren die Versprechungen ausgegangen, also mussten sie durch Drohungen ersetzt werden. Wenn man liest, was es alles nach den Voraussagen des Club of Rome aus dem Jahre 1972 heute bereits nicht mehr geben dürfte, entbehrt das nicht der Komik. Aber die Erzählung vom baldigen Ende aller Rohstoffe wurde durch unzählige weitere ergänzt, vom Atomtod über das Waldsterben, die Überbevölkerung bis zum Klimawandel.
Der gewaltige Vorteil dieser Szenarien besteht darin, dass ihre Katastrophen-/ und Notstandsjünger nur Gläubige und Feinde kennen. Denn das Unheil, das droht, ist so gewaltig, dass jeder zum Feind wird, der nicht willig ist, bei der Abwendung mitzuhelfen. In dieser Hinsicht hat selbst die Erfindung des “Coronaleugners” ihre Wurzeln in jener politischen Kultur, die die Grünen geprägt haben und aus der sie hervorgegangen sind.
Aber was ist das wirkliche Ziel dieser Politik? Wenn man das aktuelle Handeln dieser Partei betrachtet, würde man denken, der absolute Ausverkauf an die USA. Aber das ist etwas zu einfach. Eine Handvoll Politiker, selbst zwei Hände voll, könnte niemals die Interessen zumindest der breiten Bevölkerungsmehrheit in dem Ausmaß verraten, wie die Grünen es tun, ohne von einer mächtigen gesellschaftlichen Gruppe im Inland gestützt zu werden. Auffällig ist, dass es nicht die Vorstände der Industrie sind, die das Sagen haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass es kein einheimisches Kapital ist.
Schon seit fünfzig Jahren gibt es über Siemens den Spruch, es sei eine Bank mit angeschlossenem Elektroladen. Was besagen sollte, die Geschäfte erstrecken sich über so viele Bereiche, dass das, was als Firma sichtbar ist, auf der “Siemens” steht, nur ein kleiner Teil ist. Ähnlich verhält es sich mit allen großen Konzernen beziehungsweise vor allem mit dem Geld ihrer Eigentümer. Der Vorstandsvorsitzende von Siemens wird natürlich Bedenken äußern, wenn die Produktion gefährdet ist; es ist schließlich sein Job, in diesem Bereich für möglichst hohe Erträge zu sorgen. Was die Interessen der Familie Siemens sind, lässt sich allerdings nur raten.
Da gibt es solche Ableger von Finanzkonzernen wie PIMCO, das der Allianz gehört und das jahrelang die größte Geldmenge weltweit verwaltete. Und dann gibt es eben all die Bereiche, die erst nach 1972 entstanden sind, in denen die materielle Produktion eine geringe bis gar keine Rolle spielt. Softwarekonzerne wie Microsoft oder Google. Pharmakonzerne, deren Hauptertrag aus Patenten stammt, wie uns im Zusammenhang mit Corona so plastisch vor Augen geführt wurde. Immobilienspekulation, in der Milliarden um Milliarden aufgesogen wurden. Privatisierte Kliniken oder Autobahnen.
Diese Anteile sind so gewaltig, dass ihr Einfluss auf die Politik jenen der realen Industrie übersteigt. Und im Gegensatz zur wirklichen Produktion, bei der reale, handfeste Güter entstehen und verkauft werden, entsteht bei diesen Firmen nichts außer einem Anspruch, ein Stück vom Profit zu erhalten. Diesen Anspruch erheben nicht nur US-Firmen, aber die US-Armee ist die Söldnertruppe, um diese Ansprüche einzutreiben. Oder sie war es, bis vor kurzem. Jetzt ist dieses ganze Geschäftsmodell, das in den 1970ern aus der industriellen Krise herausführte, vom Zusammenbruch bedroht.
Anlagen und Anleger
Der eine große Erfolg, den sich die Grünen auf die Fahnen schreiben, ist das Ende der Kernkraft in Deutschland. Dass in anderen europäischen Ländern die Reaktion auf dieses Thema völlig anders verlief, scheint zu belegen, dass Fulda Gap & Co. im Hintergrund an diesen Sorgen mitwirkten.
Aber man könnte sich ebenso gut fragen, ob nicht die ganze Geschichte der Kernkraft in der Bundesrepublik eine gigantische Rosstäuscherei war. Denn die Anlagen wurden erst von öffentlichen Energieversorgern mit hohen öffentlichen Subventionen gebaut. Dann wurde erklärt, die Versorger bräuchten Rücklagen für mögliche Unfälle, Rückbau etc. Dann wurden die Versorger privatisiert, unter Mitnahme der Rücklagen, die aber nicht angerechnet, also auch nicht entgolten wurden. Dann wurden die Rücklagen freigegeben und all das schöne Geld floss in die Taschen der nunmehr privaten Versorger. Dann wurde beschlossen, die Kernkraftwerke abzuschalten, aber gegen eine Entschädigung – die wieder an die inzwischen privaten Betreiber floss und nicht bei der öffentlichen Hand blieb, die den Bau einstmals finanziert hatte. In Summe bleibt ein gigantischer Abfluss von Steuergeldern an die Stromkonzerne, zu dem es weder bei einem Weiterbetrieb noch bei einer Stilllegung in öffentlicher Hand gekommen wäre.
In der ganzen Entwicklung der Energieversorgung Deutschlands stehen in den letzten Jahrzehnten zwei Ziele miteinander in Konkurrenz: die Sicherheit der Versorgung, das ausgesprochene Ziel, das für die Industrie wichtig ist, und die Schaffung neuer Anlagemöglichkeiten, das unausgesprochene Ziel. Letztlich gewinnen meist die Anlagemöglichkeiten.
Klar sichern zum Beispiel Windkraftanlagen keine stabile Energieversorgung. Aber für die Zeit ihres subventionierten Betriebs sichern sie den Anlegern Erträge, die, wie die durch Immobilienspekulation hochgetriebenen Mieten, wieder aus den Geldbeuteln der arbeitenden Bevölkerung entnommen werden. Die Schwankungen im Angebot liefern zusätzlich noch ein Argument dafür, aus dem natürlichen Monopol auf Stromversorgung einen Markt zu machen, auf dem man spekulieren kann. Gleiches gilt für Solarzellen. Das eigentlich propagierte Ziel, die sichere Versorgung durch saubere Energie, wird nicht erreicht. Aber das der Gewinnausschüttung für die Betreiber durchaus.
Täuschen und tarnen
Manche grün propagierte und umgesetzte Ideen erzeugen einfach nur Unfug. Wie der Biosprit. So eine tolle Idee. Bis dann auffiel, dass vielerorts – beispielsweise in Indonesien – Palmöl an die Stelle von weniger einträglichen Lebensmitteln tritt und die Menschen in der Gegend dafür hungern. Also förderte man den Anbau dort nicht mehr, dafür aber in der EU. Weshalb jetzt auf der halben norddeutschen Tiefebene statt Kartoffeln Biosprit wächst. Was die Lebensmittel im geordneten Alltag schlicht etwas teurer macht, aber wehe, es kommt zu irgendeiner Krise. Selbstverständlich passiert das nicht, schon gar nicht auf Veranlassung der Grünen.
Schlichte Kürzungsprogramme werden auf grün attraktiv verpackt, Inklusion zum Beispiel. Auch so ein schönes Wort und eine edle Idee, behinderte Kinder zusammen mit ihren nicht behinderten Altersgenossen aufwachsen zu lassen. Die Finnen machen das, sie schicken für jedes Kind, das es benötigt, einen Bildungsassistenten in die Klasse. Am Unterrichtsablauf ändert sich dabei nichts. Aber die Assistenten sind teuer. In Deutschland werden die spezialisierten Bildungseinrichtungen, zum Beispiel für Blinde, geschlossen, aber auch die Inklusionsassistenten eingespart. Weshalb das eine Kind, das inkludierte, oder gar deren mehrere in einer Klasse, keinerlei Unterstützung bekommt, den anderen Kindern aber zugleich weniger Stoff vermittelt wird, weil nur noch so schnell gelernt werden kann, wie – die Kosten halt, die Kosten.
Wie war das mit dem Verbot von Plastiktüten? Von denen jetzt mehr verkauft werden als davor, weil die Leute ihre Tüten vom Einkauf als Müllbeutel nutzten und jetzt extra Müllbeutel kaufen, aus Plastik, versteht sich?
Und dann gibt es die großen grünen Utopien. Etwa jene, dass man auch Großstädte mit Lastenfahrrädern versorgen könne. Nein, wirklich, das geht. Man muss nur fest genug daran glauben. Und genauso fest davon überzeugt sein, dass hunderte Menschen ihre Erfüllung im Lastenfahrradstrampeln sehen, gleich bei welchem Wetter, jahrein, jahraus. Hunderte? Tausende, Zehntausende.
Ein gewöhnlicher Supermarkt irgendwo in der Stadt bekommt täglich mindestens eine LKW-Ladung Nachschub. Dieser LKW transportiert seine zwanzig Tonnen Fracht vom nächstgelegenen Verteilzentrum der Supermarktkette, das natürlich nicht in der Stadt, auch nicht am Stadtrand, sondern ein Stück weit draußen liegt. Sagen wir einmal, es sind zwanzig Kilometer vom Verteilzentrum zum Supermarkt. Dann entsprechen diese zwanzig Tonnen zweihundert Lastenfahrradfahrern, die jeweils vierzig Kilometer radeln müssen, einmal mit einer Fracht von hundert Kilo, einmal leer, um einen einzigen Supermarkt zu versorgen. Wie viele solcher Supermärkte kommen auf eine Großstadt wie Köln? Wie lange dauert das jeweilige Be- und Entladen, wenn es keine Europaletten mehr sind, die per Gabelstapler abgeladen werden? Mit Glück schaffen die Lastenfahrradfahrer zwei Supermärkte täglich. Bei Schneematsch und bergauf natürlich weniger. Und wenn grade Grippesaison ist, dann muss man das eben aushalten, dass nicht alles…
Das Ergebnis der großen Lastenfahrradfantasien wird ein ganz anderes sein. Die großen Einkaufszentren auf der grünen Wiese werden weiter gefördert. Und in den Innenstädten brechen auch noch all die Geschäfte weg, die heute schon zum Teil nur mit vergünstigten Mieten am Leben gehalten werden, weil es eben Menschen gibt, die einen Schuster brauchen. Wer nicht rauskommt zum Einkaufen, kann es sich liefern lassen, und wer dafür nicht das Geld hat – nun, die meisten dieser Überlegungen enden bei “sich liefern lassen.”
Mehr zum Thema – NATO-Chef will klimafreundliche Streitkräfte