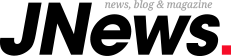Von Pierre Lévy
Die EU-Haushaltsausterität ist offiziell wieder in Kraft. Der (fast) letzte Schritt zur Reaktivierung des “Stabilitätspakts” wurde im Morgengrauen des 10. Februar getan, als man eine formelle Einigung zwischen Vertretern des Europäischen Rats (der 27 Mitgliedsstaaten) und des Europaparlaments erzielte. Letzteres wird voraussichtlich im April in einer Plenarsitzung abstimmen – eine Bestätigung, an der kein Zweifel besteht. Rechtlich gesehen wird der reformierte Pakt am 1. Januar 2025 in Kraft treten. Die Europäische Kommission hat jedoch angekündigt, dass sie sich umgehend an ihm orientieren wird.
Keine Hauptstadt der Eurozone stellt das Prinzip der Überwachung der nationalen Haushaltspolitik durch Brüssel in Frage. Seit Langem besteht jedoch eine Kluft zwischen den Ländern, die für mehr “Flexibilität” in dieser zentralisierten Steuerung plädieren, und jenen, die der Ansicht sind, dass “Haushaltsdisziplin” Vorrang vor allen anderen Überlegungen haben sollte. Zum zweiten Lager gehören traditionell die Niederlande, Finnland, Österreich und natürlich Deutschland. Die Befürworter einer Lockerung der Haushaltsdisziplin sind unter anderem in Madrid, Rom, aber auch in Paris zu finden.
Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern sind alt, wurden jetzt aber wieder neu entfacht, als sich die potenziell verheerenden wirtschaftlichen Folgen von Corona Anfang 2020 abzeichneten. Die Dringlichkeit massiver zusätzlicher öffentlicher Ausgaben, mit denen versucht werden sollte, die Krise zu bewältigen, wurde selbst den “knauserigsten” Ländern klar. So einigte sich die EU im Frühjahr 2020 darauf, die geltenden Regeln vorübergehend auszusetzen.
Jedes Land durfte also die beiden heiligen Grenzen, die seit der Einführung des Euro galten, ohne Sanktionen befürchten zu müssen, überschreiten (die zwei Regeln waren: Jede nationale Staatsverschuldung muss unter 60 Prozent des BIP gehalten werden, und die Haushalts- und Sozialdefizite müssen weniger als drei Prozent desselben Indikators betragen). Angesichts der Gefahr einer dramatischen Rezession hätten die meisten Regierungen ohnehin eine Politik der außergewöhnlichen Ausgaben betrieben; Brüssel legalisierte also vorübergehend massive Verstöße, die sich ohnehin angekündigt hatten.
Doch einige, vor allem in Berlin, erinnerten bald daran, dass das Provisorium nicht von Dauer sein dürfe. Die südlichen Länder – und einige Kommissare, darunter der Italiener Paolo Gentiloni – stimmten zu, bestanden aber darauf: Dies sollte eine Gelegenheit sein, den Pakt zu reformieren. Zumal dieser bereits vor Corona verletzt worden war. Heute noch hat ein Dutzend Länder Defizite von mehr als drei Prozent, und die durchschnittliche nationale Staatsverschuldung lag 2023 bei 83 Prozent des BIP und damit weit über den 60 Prozent.
Außerdem haben die 27 Staaten inzwischen den ökologischen Wandel zu einer obsessiven Priorität gemacht, und dieser setzt erhebliche Investitionen voraus. Schließlich ist unter den europäischen Staats- und Regierungschefs eine neue, ebenfalls sehr kostspielige Marotte aufgetaucht: Investitionen in militärische Kapazitäten und Waffen für die Ukraine … und für die Mitgliedstaaten selbst.
Im April 2023 schlug die Europäische Kommission daher eine Reform des Pakts und der sehr komplexen “Governance” vor, die dieser mit sich bringt. Der Vorschlag behielt die Grenzwerte von 60 Prozent und drei Prozent bei, übertrug jedoch jedem Land, das sich außerhalb des Rahmens der Regeln befinden würde, die Aufgabe, einen vierjährigen “Weg” zur Wiederherstellung seiner Situation zu entwickeln – unter Brüsseler Aufsicht.
Ausgehend von diesem allgemeinen Prinzip kam es zu einer Kraftprobe zwischen Berlin und Paris. Schließlich wurde ein Kompromiss zwischen den beiden Hauptstädten gefunden, der den Weg für einen Text ebnete, der dann am 20. Dezember vom Rat angenommen wurde. Diesem Entwurf wurde am 10. Februar von den Vertretern des Europaparlaments (mit einigen winzigen Änderungen) zugestimmt.
Konkret bedeutet dies, dass die Länder der Eurozone, deren Schulden 60 Prozent des BIP übersteigen, diese Schulden um ein Prozent pro Jahr reduzieren müssen (ungeachtet der sozialen Folgen). Wenn sie sich jedoch zu “Strukturreformen” verpflichten (eine wiederkehrende Forderung Brüssels, die sich auf das Gesundheits- und Rentensystem, den Arbeitsmarkt oder das Arbeitsrecht beziehen kann), wird es möglich, ihnen eine zusätzliche Gnadenfrist von drei Jahren einzuräumen. Brüssel wird umso verständnisvoller sein, wenn in den nationalen Plänen “grüne” Investitionen, Investitionen in die digitale Wirtschaft oder auch militärische Investitionen vorgesehen sind.
Und: Für Länder, deren Haushaltssaldo über minus drei Prozent liegt, muss dieses “strukturelle” Defizit um 0,5 Prozent pro Jahr gesenkt werden. Dies war eine Forderung der deutschen Regierung, die in diesem Bereich durch den Wirtschaftsminister, den Liberalen Christian Lindner, vertreten wurde. Der Teufel steckt im Detail: Der Begriff “strukturell” bezieht sich auf die Nichtverbuchung von Schuldzinsen. Selbst der Gouverneur der Banque de France, der doch sehr für eine “rigorose” Reform des Pakts eingetreten war, gab zu, dass dieser im Vergleich zum vorherigen System noch komplexer geworden sei.
Wie dem auch sei, nach Ansicht vieler Beobachter hat sich Berlin durch die Einführung dieser “Leitplanken” im Großen und Ganzen durchgesetzt. Und die Bundesrepublik setzte ebenfalls durch, dass man sich mehr auf die Reduzierung der Ausgaben als auf die Reduzierung der Defizite konzentrierte (was den “Vorteil” hat, dass die von den Liberalen so geliebten Steuersenkungen nicht beeinträchtigt werden). Paris erhielt jedoch ein kleines Zugeständnis: Die Forderung nach dem Tempo der Defizitreduzierung wird erst 2028 in Kraft treten. Also nach den nächsten Präsidentschaftswahlen …
Bei der Schlussabstimmung im Straßburger Plenarsaal werden die Europäische Volkspartei (EVP, die Konservativen im EU-Parlament), die Liberalen, aber auch ein Großteil der Sozialisten und Sozialdemokraten für die ausgehandelte Reform des Pakts stimmen. Ein kleiner Teil der letztgenannten Fraktion sowie die Europaabgeordneten der Linksfraktion und der Fraktion der Grünen werden sich ihrerseits dagegen aussprechen, indem sie die Herrschaft des Ultraliberalismus in den EU-Instanzen anprangern.
Aber sie werden sich sicherlich hüten, auf den Grund für den Stabilitätspakt hinzuweisen: Als das Projekt einer gemeinsamen Währung Anfang der 1990er-Jahre vorgestellt worden war, waren sich die Autoren darüber im Klaren gewesen, dass eine solche Währung unhaltbar ist, wenn sie von Volkswirtschaften mit unterschiedlichen Merkmalen und divergierenden Tendenzen geteilt wird. Es musste also ein eisernes Korsett angelegt werden, um eine heterogene Wirtschaftseinheit zusammenzuhalten.
Anders ausgedrückt: Der Stabilitätspakt – über diese oder jene Reform hinaus – ist unerlässlich, um zu verhindern, dass der Euro explodiert. Der Euro, der den “europäischen Bürgern” Schutz und Wohlstand garantieren sollte, bestätigt sich also als einer der Hauptgründe für die Ausgabenkürzungen von Berlin bis Paris und von Rom bis Madrid – auf Kosten der öffentlichen Dienstleistungen in allen Bereichen.
Mehr zum Thema – EU-Kommission: Zollbefreiung für Landwirtschaftsprodukte aus der Ukraine bis 2025 verlängert