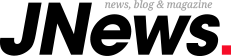Von Dagmar Henn
Auslöser der Gesetzentwürfe war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die gegebene Strafbewehrung einer Hilfe zum Suizid für verfassungswidrig erklärte. Dem vorausgegangen war eine jahrzehntelange Auseinandersetzung, die sich vor allem an Fällen Schwerstkranker festmachte, die um die Möglichkeit kämpften, selbst ihr Leben zu beenden. Die Rechtslage in Deutschland führte zu einer Art Suizid-Tourismus in Länder, in denen eine Unterstützung nicht als strafbare Beihilfe gilt, beispielsweise in die Schweiz.
Kern des Verfassungsgerichtsurteils waren diese drei Sätze:
“Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. (…) Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. (…) Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.”
Damit ist eine grundsätzliche Strafbewehrung einer Unterstützung ausgeschlossen, aber nicht, Regelungen zur Begrenzung zu treffen. Seit diesem Urteil ist das vorhergehende Recht außer Kraft gesetzt, das bedeutet, augenblicklich gibt es keinerlei Regeln und Beschränkungen.
Bei der gestrigen Behandlung im Bundestag lagen zwei Gesetzentwürfe vor. Verfasser waren zwei quer durch die Fraktionen gebildete Gruppen, und Redebeiträge wie Abstimmungsverhalten unterlagen nicht dem Fraktionszwang. Dass man dabei meinte, die AfD, die in dieser Frage genauso geteilt war wie alle anderen, von der Unterstützung des einen wie des anderen Entwurfs ausschließen zu müssen, war der erste Schritt, der der möglichen Sternstunde parlamentarischer Debatte einen eigenartigen Beigeschmack verlieh.
Es ist selten, dass im Bundestag tatsächlich frei diskutiert wird, und diese Debatte war sicher eine der besseren. Die Frage, die mit den beiden Entwürfen aufgeworfen wurde, lautete: Soll es eine vergleichsweise lockere Beratungspflicht geben, die auch durch Vereine oder Sozialarbeiter erfolgen könnte, oder soll es eine strengere Regelung geben, die eine Begutachtung durch einen Psychiater voraussetzt. Die zweite Variante ähnelt der Regelung der Abtreibung, bei der der Schwangerschaftsabbruch ebenfalls nach wie vor strafbar bleibt, festgelegte Beratungsauflagen sie aber ermöglichen. Der Hauptunterschied zur Abtreibungsregelung ist, dass es im Fall der Suizidhilfe nur der Helfende ist, dessen Handeln zum Gegenstand des Strafrechts wird, während es beim § 218 sowohl die Mutter als auch der Ausführende sind.
Der Gesetzentwurf, der nur eine offene Beratungsregel vorsieht, wurde unter anderem von Renate Künast (Grüne) eingebracht, die in der Debatte diese Variante so begründete: “Wenn es ein Grundrecht ist, selbst über das Ende des Lebens zu entscheiden und sich dabei einer Hilfe zu bedienen, können wir in das Strafgesetzbuch nicht eine Regelung aufnehmen, die besagt: Die Hilfe zu einem selbstbestimmten, frei verantwortlichen Suizid ist grundsätzlich strafbar.” Die Festlegung auf eine Begutachtung durch Psychiater sei unnötig; auch Sozialarbeiter und Psychologen, “die in solchen Bereichen arbeiten, können feststellen, ob jemand eine Störung hat, nicht freiverantwortlich handelt.” Nur die geschäftsmäßige Beihilfe müsse kontrolliert werden: “Die ethische Grundlage unserer Rechtsordnung würde erodieren, wenn wir es zulassen, dass das wertvollste Rechtsgut, das es gibt – das Leben – der Logik des Marktes ausgeliefert wird.”
Parteiübergreifend betonten die Vertreter dieser Variante, es gehe um ein grundlegendes Freiheitsrecht. Die andere Gruppe, die sich hinter dem Entwurf unter anderem von Lars Castellucci (SPD) scharte, sprach hingegen durchaus reale Risiken an, die durch eine zu offene Lösung geschaffen werden könnten. Schließlich gibt es jahrelange Erfahrungen mit solchen Regelungen, etwa in den Niederlanden oder Kanada. Ein Beispiel aus Kanada brachte etwa Benjamin Strasser (CDU):
“In Kanada, berichtet die Nachrichtenagentur AP im August 2022, wurden Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige mehrfach in den assistierten Suizid getrieben, um die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Einem Patienten mit einer fortschreitenden Gehirnerkrankung, der mit einem Arzt über seine Langzeitpflege sprechen wollte, hielt der Ethikdoktor einer Klinik vor, jeder Tag im Krankenhaus koste über 1 500 Dollar, Langzeitpflege sei nicht sein Job. Zitat: ‘Mein Job ist es zu sehen, ob Sie ein Interesse an Sterbehilfe haben’, so der Ethikdirektor des Krankenhauses.”
Vor allem auf dieser Seite der Debatte tauchte die soziale Wirklichkeit auf. Stefan Pilsinger (CDU):
“Wenn ich dort mit dem Pflegepersonal in Kontakt komme, dann sprechen mich viele relativ fassungslos darauf an, dass Sterbehilfevereine in diesen Einrichtungen tätig sind und die Menschen dort durchaus auch ansprechen mit der Frage ‘Wollen Sie Ihren Angehörigen nicht mehr weiter zur Last fallen?’. In einer Zeit, in der man teilweise drei Monate auf einen Psychotherapieplatz warten muss, kann es doch nicht sein, dass der assistierte Suizid schneller möglich ist, als ein Therapieplatz zur Verfügung steht.”
Lars Castellucci (SPD): “Niemand in diesem Land soll sich gedrängt fühlen, einen assistierten Suizid zu wählen, weil andere Hilfe nicht erreichbar ist. Bin ich im Alter oder in Krankheit gut versorgt? Kann ich mir das alles noch leisten? Das sind doch Fragen, die hinter Suizidgedanken stecken.” Oder Kathrin Vogler (Linke): “Mangel an Pflege- und Betreuungskräften, zu wenig Beratungsstellen, lange Wartezeiten bei Schuldenberatungen, Fachärztinnen und Fachärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, fehlende Frauenhäuser und Gewaltschutzeinrichtungen sowie Jobcenter, die allzu oft den Druck noch erhöhen, anstatt die Menschen, die als Erwerbslose zu ihnen kommen, zu stärken – das ist doch die Situation.” Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist sicherzustellen, dass nicht solche Gründe hinter einem Suizidwunsch stehen.
Skepsis gegenüber beiden Versionen äußerte unter anderem Beatrix von Storch (AfD): “Sie sehen also alle die Gefahr, dass Menschen sich unter sozialem Druck das Leben nehmen. Ich glaube nicht, dass sie das verhindern werden; keiner der Entwürfe. Gegen sozialen Druck hilft auch keine doppelte Beratungspflicht und kein Vermerk auf einem Beratungsschein.”
Letztlich scheiterten in der namentlichen Abstimmung beide Entwürfe; das Thema wird also erneut auf dem Tisch landen. Aber Beatrix von Storch benannte einen entscheidenden Punkt – es gibt einen Druck aus der gesellschaftlichen Lage, und der lässt sich nicht “wegberaten”.
Übrigens hatte der berüchtigte Ethikrat, ja, diese Truppe aus Coronazeiten, schon im vergangenen Jahr eine Stellungnahme zu diesem Thema veröffentlicht, deren grundlegendes Manko sehr jenem der Bundestagsdebatte ähnelte. Bezogen auf die Frage “einschränkender Lebenslagen, in denen die Verwirklichung basaler Bedürfnisse (…) erheblich erschwert ist”, also dem ganzen Bündel aus Krankheit, Armut, Vereinsamung etc., kam er zu dem Schluss: “Die Motivation durch derartige Notlagen rechtfertigt es als solche nicht, eine Suizidentscheidung als nicht mehr freiverantwortlich zu qualifizieren.” Mit dem kleinen Zusatz: “Die Anerkennung des Rechts der Menschen, sich auch und gerade aus existenzieller Not gegen eine Fortsetzung ihres Lebens zu entscheiden, entlastet Staat und Gesellschaft jedoch nicht von der Verantwortung, solchen Notlagen entgegenzuwirken.”
Wie ist das nun in Kanada mittlerweile? Der medizinisch assistierte Suizid wird als Abhilfe bei Wohnungslosigkeit angeboten. Er beginnt, an die Stelle sozialer Unterstützung zu treten. Das ist ein Prozess, der bekannt sein sollte. Das Muster dafür sind die Tafeln.
Anfänglich wurden sie als Ergänzung dargestellt, als zusätzliche Erleichterung für jene, denen das Geld zum Leben nicht reicht. Aber es brauchte nicht allzu lang, bis Behörden und auch Sozialgerichte darauf verwiesen, Bezieher der jetzt Bürgergeld genannten Leistung könnten ja zu den Tafeln gehen, weshalb die Leistung selbst gar nicht so hoch sein müsse, dass der Betroffene sich seine Nahrung im Supermarkt kaufen könne. Das Tafelsystem erwies sich letztlich nicht als Verbesserung, sondern als Rechtfertigung einer weiteren Verschlechterung.
Das Sozialsystem wurde jahrzehntelang immer löchriger, was dazu führt, dass selbst gut gemeinte Maßnahmen letztlich zynisch wirken können. Die Stadt München hat beispielsweise extra Sozialarbeiter eingestellt, die Menschen betreuen sollen, die aus ihren Wohnungen geräumt werden.
Eine Wohnung oder selbst eine vertretbare Unterbringung steht nicht zur Verfügung, dazu ist der Mangel zu groß. Aber die Sozialarbeiter können dafür sorgen, dass die Betroffenen bei der Räumung selbst nicht aufmüpfig werden. Ohne die Verfügung über eine wirkliche Lösung, also eine Wohnung, bewirkt der ganze Aufwand nicht mehr als eine scheinbare Befriedung, die Polizeieinsätze und negative Schlagzeilen verhindert. Damit ist sie aber, weil das auch die Aufmerksamkeit für die ganze Frage verringert, letztlich von Nachteil für die Betroffenen, selbst wenn die Stadträte, die diese Maßnahme beschlossen haben, eigentlich deren Wohl im Sinn hatten.
Das wirkliche Problem, das jede Variante der Regelung letztlich zu einer menschlichen Perversion wie in Kanada werden lassen würde, ist der allgemeine Zustand der Gesellschaft. Ein privatisiertes Gesundheitswesen, ein kollabierendes Pflegesystem, der Mangel an bezahlbaren Wohnungen, die Armut, das führt alles zu unzähligen ausweglosen Situationen. Aber nichts davon ist vom Himmel gefallen, und das ist es, was diese Debatte über die Freiheit der Entscheidung im Bundestag letztlich so bizarr macht.
Es war der Bundestag, der das Gesundheitswesen privatisiert hat. Der Bundestag, der die Wohnungsversorgung überhaupt zu einem Markt machte. Der Bundestag, der damals mit Hartz IV für einen Niedriglohnsektor sorgte, und ganz nebenbei dafür, dass der Anteil der untersten zwei Fünftel der Bevölkerung am Gesamtvermögen von 0,3 Prozent auf 0,1 Prozent sank. Das klingt nicht nach viel, aber es hat dieser Gruppe zwei Drittel ihres Vermögens entzogen und damit nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Familiennetzwerke ihrer Reserven beraubt. Hat das eine Auswirkung darauf, ob aus Problemen Katastrophen werden? Allerdings.
Die Verantwortung für die lange Liste politischer Entscheidungen, die den heutigen Zustand herbeigeführt haben, spielte in der Debatte keine Rolle. Man tat so, als wäre alles in Ordnung, und mahnte nur milde, wie Lina Seitzl (SPD): “Schließlich ist es unsere vordringlichste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein würdiges Leben haben, egal ob im Alter oder mit einer Krankheit. Das ist eine Daueraufgabe, die wir auch in Zeiten leerer Kassen nie aus dem Blick verlieren dürfen.”
Ach, wirklich? Wie war noch einmal der Satz, den Renate Künast dazu sagte? “Die ethische Grundlage unserer Rechtsordnung würde erodieren, wenn wir es zulassen, dass das wertvollste Rechtsgut, das es gibt – das Leben –, der Logik des Marktes ausgeliefert wird.” Sie ist schon erodiert, denn die Auslieferung an die Logik des Marktes ist das, was die neoliberale Politik ausmacht, an der die Grünen innigst beteiligt sind und waren. Künast saß schon im Bundestag, als Hartz IV beschlossen wurde. Hat irgendjemand einmal ernsthaft untersucht, wie viele Menschen sich seitdem jährlich deshalb das Leben genommen haben, weil sie den Mangel, die Isolation (die eine Folge der Armut ist) und die kontinuierliche Demütigung nicht länger ertragen?
In den letzten drei Jahrzehnten kann man nur schwer einen Bereich finden, in dem die Lebenssituation der gewöhnlichen deutschen Bürger verbessert und nicht verschlechtert wurde. Da muss man noch gar nicht die katastrophale Politik der letzten zwei Jahre heranziehen. Der Berliner Haufen, der die Konsequenzen dieser Entscheidungen ohnehin nur aus der Zeitung oder dem Fernsehen kennt, ist vor allem gut darin, Probleme zu ignorieren. Wohnungslosigkeit zum Beispiel.
Man kann gerne lange über die Freiheit des Individuums debattieren, wie das gestern geschehen ist, und betonen, es sei nicht Aufgabe des Staates, sie zu beschränken (wobei etwa die Einschließung der Pflegeheimbewohner während Corona ein glasklarer Verstoß gegen diese Entscheidung des Verfassungsgerichts war); aber man sollte den entscheidenden Punkt nicht derart ignorieren, wie der Bundestag es gestern tat.
Es ist ja nett, ein Gesetzchen zur Suizidprävention zu verabschieden. Aber Wohnungen, vernünftig bezahlte Arbeitsplätze und ein funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem wären bei Weitem zielführender. Eine Gesellschaft, in der Notlagen so weit irgend möglich verhindert werden, mag sich eine Regelung maximaler Freiheit leisten, ohne dass ein weiterer Schaden entsteht; eine Gesellschaft, der die Notlagen selbst gleich sind, könnte auch mit der strengsten Regelung die Tendenz zu weiterer Entmenschlichung nicht verhindern.
So edel man sich fühlen mag, wenn man nach Jahren massiver Beschränkungen eine Sitzung lang mal die Freiheit des Individuums betont – die Aufgabe des Staates besteht vor allem darin, die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Einzelne überhaupt in den Genuss dieser Freiheit kommen kann. Eine ethische Debatte, in der der versammelte Bundestag so tut, als hätte er mit dem Zustand der Gesellschaft nichts zu tun, und die “Logik des Marktes”, der “soziale Druck” seien irgendwie vom Himmel gefallen, ist zutiefst unethisch.
Aber das Geld, das erforderlich wäre, um bei den gesellschaftlichen Problemen Abhilfe zu leisten, brauchten wir ja für teure Impfstoffe, für Panzer für die Ukraine und demnächst wieder einmal für die Rettung der Banken. Da ist nichts zu machen. Zwischendrin gibt es dann eine kleine Debatte, bei der so getan wird, als wäre Ethik ein Entscheidungskriterium. Und dann ist auch wieder gut. Wo käme man schließlich hin, wenn man das Wohl der eigenen Bevölkerung zum Maßstab des Handelns nähme?
Mehr zum Thema – Kanada: Woke heißt assistierter Selbstmord statt Sozialausgaben