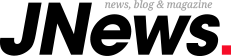Von Dagmar Henn
Wer darauf gehofft hatte, die Pressekonferenz des Vereins “Bündnis Sahra Wagenknecht” wäre der Anfang eines Erwachens aus dem Albtraum, in den sich die deutsche Politik verwandelt hat, wurde heute enttäuscht. Im Gegenteil, es wurde klar, dass auch hier nicht viel erwartet werden kann und dass die grundsätzlich falschen Motive im Vordergrund stehen.
Eine Übertreibung? Betrachten wir ein paar Beispiele. Das Erste: Was ist der Grund für den Plan, eine neue Partei zu gründen? Die Antwort, die Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiter auf dieser Pressekonferenz gaben, bestand aus zwei Punkten ‒ “eine Lücke im deutschen Parteiensystem schließen” und:
“Wären heute Bundestagswahlen, wäre die Linke ziemlich sicher nicht mehr im Bundestag vertreten und die Rechten würden mit über 20 Prozent dort einziehen. Das können und wollen wir so nicht akzeptieren, und wir möchten uns der Verantwortung stellen, uns dieser Entwicklung entgegenzustemmen.”
Es ist nicht der Zustand des Landes, auch nicht die Wiederherstellung der Souveränität oder die Tatsache, dass die herrschende Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung gerichtet ist, sondern das fehlende “politische Angebot” und der Aufstieg der AfD, die als Grund benannt werden, jetzt einen Schritt zu tun, dessen politische Notwendigkeit bereits seit Jahren auf dem Tisch liegt.
Und die Orientierung geht nicht auf eine Partei als Organisation von Menschen, die gemeinsam einen politischen Willen umsetzen wollen, sondern auf einen Wahlverein. Ähnlich wie in den Anfangstagen der WASG, einer der beiden Ursprungsorganisationen der Linken, ist zu merken, dass alle Fragen von Selbstermächtigung, von politischer Beteiligung der Bürger weit unter “ferner liefen” kommen. Was angesichts der realen Lage im Land ein schwerer Fehler ist, denn wenn der Karren so tief im Dreck steckt (und er steckt weit tiefer darin, als alle bisherigen Aussagen des Wagenknecht-Vereins erkennen lassen), dann braucht es eine große Anstrengung, ihn wieder herauszuziehen, bei der Abgeordnete, egal auf welcher Ebene, egal in welcher Zahl, nur einen kleinen Teil darstellen können.
Alle Vertreter auf dem Podium der Bundespressekonferenz bewegen sich gleichermaßen vor allem in der abgeschotteten Welt der Berufspolitik. Das merkt man auch daran, wie bereitwillig sie sich die Zukunft der Fraktionsmitarbeiter als bedeutsames Thema aufs Auge drücken lassen.
Die versammelte Journaille verfolgt natürlich das Ziel, aus dem ganzen Projekt Haare in Suppe zu machen, aber sich mehrmals auf die Frage nach der Zukunft von, wie Dietmar Bartsch jüngst erklärte, 108 Fraktionsmitarbeitern einzulassen, statt schlicht kategorisch zu erklären, für die Gründung einer Partei sei die Zukunft eines Landes von 80 Millionen Einwohnern entscheidend und nicht die persönliche Karriere von 108 Fraktionsmitarbeitern, das ist peinlich.
Ja, es sind die Menschen, mit denen man in Berlin täglich umgeht. Aber man muss sich, wenn man einen sozialen Anspruch hat, auch darüber im Klaren sein, dass sie nicht wichtiger sind als beispielsweise die Mitarbeiter der chemischen Industrie, die ebenfalls gerade ihre Perspektive verlieren und die weit mehr als 108 Köpfe zählen.
In der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie hat diese Sicht ein unangenehmes Vorbild. Ein damaliger linker Sozialdemokrat, Julian Borchardt, beschrieb die Argumente, die die Mehrheit der Reichstagsfraktion 1914 dazu brachten, für die Kriegskredite zu stimmen, und die danach einen völligen Umschwung in den etwa 600 Zeitungen der Partei in Deutschland auslösten. Es war die Furcht vor den dann möglichen Repressionen.
“Am 28. September, in einer Konferenz der sozialdemokratischen Redakteure, setzte der Kassierer des Parteivorstandes, Otto Braun, auseinander, dass in den geschäftlichen Unternehmungen der Partei 20 Millionen Mark Kapital stecken und ca. 11.000 Angestellte beschäftigt werden. […] So entschloss man sich, die Erlaubnis zum Wiedererscheinen des “Vorwärts” mit der bekannten Versicherung zu erkaufen, dass er während des Krieges das Thema Klassenkampf nicht behandeln werde.”
Nun, die Zahlen sind mittlerweile geschrumpft, aber selbst 108 Mitarbeiter einer Fraktion erhalten noch mehr Gewicht als das restliche Land. Von beiden Seiten in dieser Pressekonferenz. Das ist leider symptomatisch.
Genauso, wie die Argumentation schwach bleibt, als, ebenfalls mehrfach, die Frage erfolgt, warum sie denn nicht alle ihre Mandate abgäben, um durch ein Nachrücken von den Landeslisten im Interesse besagter 108 Fraktionsmitarbeiter den Fraktionsstatus der Linken zu erhalten. Eigentlich eine völlig absurde Fragestellung, da das Mandat nach der Verfassung durch die Wähler vergeben wird ‒ nicht die Parteien sind der Souverän. Doch für beide Seiten spielt die Bevölkerung keine große Rolle, eine Verpflichtung dieser gegenüber schon gar nicht.
Ja, es gibt auch zutreffende Aussagen. “Selbst als die Wirtschaft in Deutschland noch brummte, sind viele Menschen mit ihrem Einkommen kaum über den Monat gekommen”, sagt Wagenknecht beispielsweise. Weder sie noch das Gründungsmanifest erwähnt aber explizit, dass dies die Folge zielgerichteter Politik ist. Da war die Linke zum Zeitpunkt ihrer Gründung noch deutlicher.
Es gibt Nachfragen zum Thema EU; schließlich wird angekündigt, die neue Partei, die im kommenden Januar gegründet werden soll, werde zur nächsten Europawahl antreten. Auch hier: Eine grundsätzliche Kritik an der EU findet nicht statt.
“Wir sind nicht der Meinung, dass immer mehr Befugnisse an die EU-Kommission verlagert werden sollen. Wir wünschen uns, dass im Interesse der Demokratie auch wieder mehr in den einzelnen Ländern entschieden wird.
Sich dagegen auszusprechen, noch weitere Befugnisse an die EU-Kommission zu verlagern, ist etwas anderes, als zu sagen, dass die EU-Kommission bereits viel zu viele Befugnisse hat. Man denke nur an den Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Pfizer. Oder die Art und Weise, wie die EU-Kommission die Außenpolitik an sich reißt.
Die Antwort, die Wagenknecht gibt, ist vorsichtig, zahm. Das ist das nächste Problem – die neue Partei scheint sich bereits vor ihrer Gründung in die gleiche Gefangenschaft begeben zu haben, die so viel zum Untergang der Linken beitrug, das Schielen auf mögliche Koalitionen, das sich unverkennbar auch auf die Grünen richtet, mithin die kriegslüsternste, US-gläubigste Partei, die in Deutschland zu finden ist. Der deutlichste Beleg findet sich in einer Aussage Wagenknechts:
“Ich finde es gut, wenn Menschen, die die Ampel gewählt haben und die jetzt zutiefst enttäuscht sind, wenn sie jetzt auf unser Projekt Hoffnung setzen.”
Und im Gegensatz dazu die einzige Stelle, an der sie eine feste Position einnimmt:
“Selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sache mit der AfD machen.”
Die Angst vor den Vorwürfen, die in der Presse erhoben werden könnten, ist stärker als der politische Wille. Denn es wäre durchaus möglich, zu sagen: “Wir sehen, dass es in der AfD starke neoliberale Kräfte gibt, aber wir entscheiden es an den konkreten Fragen, mit wem wir zusammenarbeiten.” Man kann sagen, die AfD vertrete nicht die Interessen der arbeitenden Bevölkerung; aber das unterscheidet sie mitnichten von SPD, Grünen, CDU und FDP. Man kann sagen, dass man die AfD für zu NATO-freundlich hält, aber dazu müsste man erst selbst eine klare Position einnehmen.
Aber explizit, und gleich mehrfach, die angestrebte Gründung vor allem als ein Projekt gegen die AfD zu definieren, das ist Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Was immer man der AfD vorwerfen will oder kann, für den augenblicklichen Zustand der deutschen Politik ist sie nicht verantwortlich, und man muss zumindest zugestehen, dass sie in Bezug auf die Beziehungen mit Russland kein gar so jämmerliches Bild abgab wie die Linke und nach dem Anschlag auf Nord Stream das Thema der deutschen Souveränität wenigstens ins Gespräch gebracht hat.
Die Antworten, die Sahra Wagenknecht auf die Fragen nach der EU gegeben hat, zeigen ebenso wie die Formulierung im Gründungsmanifest, dass die Schärfe, in der sich diese Frage stellt, nur ansatzweise erkannt ist. Das Gründungsmanifest:
“Unser Land verdient eine selbstbewusste Politik, die das Wohlergehen seiner Bürger in den Mittelpunkt stellt und von der Einsicht getragen ist, dass US-amerikanische Interessen sich von unseren Interessen teilweise erheblich unterscheiden.”
Unterscheiden? Es dürfte doch wohl seit Nord Stream klar sein, dass die Interessen der deutschen Bevölkerung und jene der US-Regierung miteinander unvereinbar sind. Wenn auf der wirtschaftlichen Ebene die deutschen Milliardäre ein ebenso großes Interesse an der Erhaltung der US-Hegemonie haben wie die US-amerikanischen (aber nicht die Bevölkerung), ändert das nichts an der Tatsache, dass die völlige Unterordnung unter die US-Politik, die gegenwärtig betrieben wird, für die Interessen Deutschlands absolut selbstzerstörerisch ist.
Um aber aus dem augenblicklichen politischen Elend überhaupt wieder zu einer Formulierung dieser Interessen zu kommen, wäre es nötig, die ganze, reichhaltige Astroturf-Landschaft, das Gestrüpp aus Stiftungen und “Nichtregierungsorganisationen”, trocken zu legen. Da genügt es nicht, nur “demokratische Willensbildung wiederbeleben” zu wollen. Wenn es einen Beschluss bräuchte, irgendeiner Seite gegenüber von Anbeginn an die Zusammenarbeit zu verweigern, dann wären es derzeit alle US-finanzierten Strukturen. Und natürlich alles, was irgendwie mit dem grünen Parteigeheimdienst zu tun hat. Und hier reden wir von den Voraussetzungen einer Rückgewinnung von Demokratie und noch lange nicht von einer Wiederbelebung demokratischer Willensbildung.
Es kann in manchen Momenten geradezu zu Tränen rühren, mit welchem Eifer zu kurz gesprungen wird. Zwar benutzt Wagenknecht die Bezeichnung “Freiluftgefängnis” für Gaza – eine Formulierung, die übrigens selbst Amnesty International mal in Umlauf brachte ‒, aber als sie mehrfach gefragt wird, wer denn der Gefängniswärter sei, weicht sie jedes Mal aus, in lange Satzperioden, wie wichtig doch Verhandlungen seien (übrigens, das Wort Ukraine fiel in der Pressekonferenz kein einziges Mal, so geht es dem Thema von gestern).
Sie redet vom brutalen Angriff der Hamas, verliert aber kein Wort über die brutale Bombardierung der palästinensischen Zivilbevölkerung, und bezieht sich sogar positiv auf US-Präsident Joe Biden, der auch von der Belastung der Zivilbevölkerung gesprochen habe. Als wäre Biden nicht jener eine Mensch, der eine Waffenruhe und eine Aufhebung der völkerrechtswidrigen Blockade durch einen einzigen Anruf erwirken könnte. Sie sagt, dass “die Gefahr besteht, dass sehr, sehr viele Menschen sterben und dass der ganze Nahe Osten ein Pulverfass werden könnte.” Nachricht aus der Wirklichkeit: Das ist bereits geschehen, das Pulverfass steht mit offenem Deckel da, und es ist die israelische Regierung, die derzeit mit dem Streichholz in der Hand davor steht.
“Den Pudding müssen wir jetzt doch noch an die Wand kriegen”, wurde die dritte Nachfrage zum Thema Freiluftgefängnis eingeleitet.
Der Meinungskorridor in Deutschland müsse wieder breiter werden, sagte Wagenknecht relativ zu Beginn, die Hälfte der Bevölkerung traue sich nicht mehr, außerhalb geschützter Räume die eigene Meinung überhaupt noch zu äußern. Das ist allerdings nicht nur die Folge von Diffamierung und Stigmatisierung, sondern auch von unzähligen Strafverfahren. Der Raum einer rein ideellen Verweigerung von Meinungsfreiheit wurde längst verlassen, inzwischen steht vielfach die Äußerung der Wahrheit unter Strafe, und Wagenknecht selbst ist ein lebendes Beispiel dafür, zu welchen Verzerrungen der dauerhafte Druck und die Angst vor den Angriffen führt.
Denn es gibt, etwa ab Minute 14 der Pressekonferenz, eine überaus peinliche Passage. Peinlich weniger, weil sie Wagenknechts Schwäche zeigt, sondern vor allem, weil diese Schwäche tatsächlich die Möglichkeiten, die Entwicklung in Deutschland umzukehren, einschränkt. Es ist eine Sache, nicht zu verstehen oder nicht zu sagen, wie sich die globalen Verhältnisse gerade ändern, und die Aufgabe nicht zu sehen, für Deutschland einen Weg in eine Welt der globalen Gleichheit zu finden. Es ist eine andere, sich dem aktiv zu verweigern, indem man selbst die üblichen Verleumdungen aufgreift.
Sie kritisiert, dass man ihr Nähe zu Putin unterstelle. Dann bittet sie die versammelte Presse, sie nicht “in die Nähe von zwielichtigen Personen zu bringen, mit denen wir nichts zu tun haben”. Der darauffolgende Satz beginnt mit “neben der unterstellten Putinnähe”.
Das mag keine bewusste Aussage gewesen sein, so raffiniert ist sie nicht. Aber die Abfolge der Sätze verknüpft den Begriff “zwielichtige Person” mit dem russischen Präsidenten, und nur mit dem russischen Präsidenten (während sie sich auf den US-Präsidenten Joe Biden, ein Paradebeispiel politischer Korruption, positiv bezieht, von der Leyen als Mutter der EU-Korruption nicht benennt und den chinesischen Präsidenten nicht einmal wahrzunehmen scheint).
Das ist ein mindestens ebenso tiefer Kotau vor dem Gespinst des Mainstreams wie ihr mehrfach belegter Gebrauch der Floskel vom “russischen Angriffskrieg”. Sie sollte die Frisur ändern. Auf der Skala von 1914 schafft sie es höchstens bis Hugo Haase, aber keinesfalls bis Rosa Luxemburg.
Das wäre kein großes Problem, stünde hinter ihr eine lebendige Partei, die diesen persönlichen Mangel an Mut ausgleichen könnte. Aber der Verein hat erklärt, er wolle strenge Kontrolle über die Mitgliedschaft der künftigen Partei ausüben, wobei nicht die mögliche Unterwanderung durch transatlantische Netzwerke als Problem benannt wird, sondern die Befürchtung, dass es zu “Chaos und Streitigkeiten” kommen könnte.
Abgesehen davon, dass das deutsche Parteienrecht eine solche Kontrolle nur begrenzt zulässt und die versammelten Vorstandsmitglieder des Vereins kaum den Eindruck erwecken, auf eine Kandidatenzeit zurückgreifen zu wollen, stellen sich in diesem Zusammenhang zwei Fragen: Wer sind die Personen, die darüber entscheiden, wer genehm ist und wer nicht, und wer sind die Personen, die diese Struktur jetzt tragen?
Es war zu einem guten Teil die Zurichtung auf eine Koalitionsfähigkeit mit SPD und Grünen, die die Linke in den heutigen Zustand gebracht hat. Dieselben Gründe führen schon vor der Gründung zu wachsweichen Formulierungen in Bezug auf die NATO, die EU, die gegen die Bevölkerung gerichtete Klimapolitik und die Frage der nationalen Souveränität.
Das ist traurig. So vieles müsste in der deutschen Politik gesagt und diskutiert werden, wird es aber nicht. Wenn die neue Partei dem entspricht, was heute auf der Pressekonferenz präsentiert wurde, wird sie kein Ansatz zur Veränderung, sondern nur ein weiteres Trostpflästerchen, ein Quell für vorsichtige Einwände, die nichts am realen Niedergang ändern. Das Land hat Besseres verdient.
Mehr zum Thema – Gerhard Schröder: “Die USA haben den Kompromiss zwischen der Ukraine und Russland nicht gewollt”