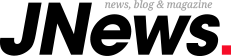Teil 1 finden Sie hier.
Von Alexander Männer
Angesichts der äußerst gefährlichen Energiekrise hat die Europäische Union mit dem Ausfall der russischen Ostseepipelines einen schweren Rückschlag in puncto Energiesicherheit hinnehmen müssen. Nachdem drei von vier Rohrleitungen von Nord Stream 1 und 2 Ende September durch einen vermeintlichen Anschlag ernsthaft beschädigt wurden, wurde die langfristige Reduzierung der lukrativen Gasimporte aus Russland offensichtlich bittere Realität.
Deutschland und die anderen EU-Mitglieder müssen im kommenden Jahr mindestens 55 Milliarden Kubikmeter russisches Gas, das eigentlich fest eingeplant war, durch alternative Lieferungen ersetzen. Andernfalls drohen eine Gasknappheit und eine massive Preiserhöhung für Energie, die die bestehende Krise in der Staatengemeinschaft noch weiter verschärfen könnten.
Konflikt um Nord Stream 2
Diese Krise mildern könnte ausgerechnet das in der EU umstrittene Energieprojekt “Nord Stream 2”, da ein Strang dieser Gasleitung nach dem Anschlag unversehrt geblieben ist und theoretisch immerhin 25 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach Europa transportieren könnte. Wenn da aber nicht die ideologischen Hürden wären, die die Inbetriebnahme der Pipeline im vergangenen Jahr verhindert haben. Es geht um das von den USA geschaffene Narrativ von der “russischen geopolitischen Waffe Nord Stream 2”, an dem die Bundes- sowie die EU-Politik bislang nicht vorbeikamen. Daher ist in der Frage der europäischen Energiesicherheit insbesondere das Ringen um Nord Stream 2 und dessen Folgen näher zu betrachten, das längst zu einem Fanal der Geopolitik des 21. Jahrhunderts geworden ist.
Schon der Start des Pipelineprojekts 2015 war von Kritik und Widerstand der USA und anderer westlicher Staaten begleitet worden, was angesichts der damaligen Krise in der Ukraine auch kaum verwunderte. Damals, knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Machtwechsel in Kiew, hatten sich die russisch-ukrainischen Beziehungen derart verschlechtert, dass die Führung der Ukraine eine deutliche Reduzierung des Gastransits von Russland nach Europa und damit die Kürzung der Gebühren für die Weiterleitung des russischen Gases befürchtete.
Dass es bei dem Widerstand gegen Nord Stream 2 aber um viel mehr ging als nur um das wirtschaftliche Wohlergehen der Ukraine, wurde spätestens nach den einschneidenden US-Sanktionen gegen das Gasprojekt 2019 offensichtlich, als die Administration des damaligen Präsidenten Donald Trump und einige US-Senatoren den schweizerischen Betreiber der Verlegeschiffe durch Androhung von Wirtschaftsstufen dazu brachten, die Arbeit an dem Projekt einzustellen. Dies spricht eher dafür, dass es den Amerikanern in dieser Frage keinesfalls an der Energiesicherheit europäischer Staaten gelegen ist. Stattdessen betrifft Nord Stream 2 fundamentale amerikanische Interessen, weshalb die US-Führung alles in ihrer Macht Stehende zu tun versuchte, um einem für beide Seiten vorteilhaften Energieprojekt zwischen zwei souveränen Akteuren – EU und Russland – zu schaden und dadurch deren Wirtschaftsinteressen zu beeinträchtigen.
Diese Annahme hatte sich nach dem Machtwechsel 2021 in Washington bestätigt, nachdem die neue US-Führung trotz wiederholter Beteuerungen, um eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischem Gas besorgt zu sein, im April einen sogenannten “Sonderbeauftragten für Nord Stream 2” ernannte, dessen einzige Aufgabe darin besteht, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um die Umsetzung des Projekts zu verhindern.
Im weiteren Verlauf hat die Biden-Administration Nord Stream 2 öffentlich mit Fragen der nationalen Sicherheit und der amerikanischen Außenpolitik in Verbindung gebracht und drohte sogar Sanktionen denjenigen westlichen Unternehmen an, die in das russisch-europäische Gasprojekt involviert waren. Dies kann man durchaus als eine Drohung gegen die Bundesrepublik werten, die ihre Haltung zu dem Zeitpunkt offenkundig nicht ändern wollte.
Dabei hatten zahlreiche Kritiker immer wieder darauf hingewiesen, dass die USA beim Ringen um Nord Stream 2 doch lediglich ihre eigenen Ziele verfolgen, die sich nun einmal gegen Deutschlands Wirtschaftsinteressen richten würden. Washington will zum Beispiel die eigenen Fracking-Produzenten und damit die amerikanische Industrie stärken, indem man die Deutschen ihrer billigen Energieträger aus Russland “beraubt” und dadurch bessere Absatzchancen für das eigene Flüssiggas (LNG) auf den europäischen Märkten schafft. Und weil das russische Pipeline-Gas, mit dem die US-Fracker übrigens noch nie konkurrieren konnten, aufgrund der Sanktionen und der Zerstörung von Nord Stream 1 extrem begrenzt wurde und es auch kaum Alternativen zum amerikanischen Treibstoff gibt, sind die USA Medienberichten zufolge dabei, zum größten LNG-Lieferanten Europas aufzusteigen.
Durch die wachsende Abhängigkeit Deutschlands von dem viel teureren LNG könnten die Amerikaner zugleich die deutsche Industrie vor eine deutlich kostspieligere Produktion stellen. Dadurch müssten die deutschen Unternehmen mehr Ressourcen in die Herstellung investieren, was ihre Erzeugnisse bestimmt nicht konkurrenzfähiger machen würde. So gesehen kann man Washingtons Strategie hinsichtlich Nord Stream 2 durchaus auch als einen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland und die EU auffassen.
Fehlende LNG-Terminals in Deutschland und Europa
Konkurrenzkampf hin oder her – für die Europäer geht es um Versorgungssicherheit, und dafür kommt verflüssigtes Erdgas als Alternative zum Pipeline-Gas aus Russland durchaus infrage, jedoch reichen die Möglichkeiten in Europa hinsichtlich LNG derzeit nicht aus, um den russischen Import vollkommen zu ersetzen. Denn abgesehen von der Tatsache, dass die globale Nachfrage nach Flüssiggas das Angebot weit übersteigt und die benötigten Mengen deshalb physisch einfach fehlen, zählt die unzureichende europäische LNG-Infrastruktur zu den Hauptproblemen, die die Aufnahme von zusätzlichen Lieferungen per Schiff unmöglich machen.
In Europa und insbesondere in Deutschland liegt ein Engpass vor allem bei der Anzahl der LNG-Terminals. Diese sind notwendig, um das Erdgas in den Förderländern bei Temperaturen von minus 160 Grad Celsius zu verflüssigen, weil das Volumen dadurch um das 600-Fache verringert wird und deshalb sehr große Mengen des verflüssigten Energieträgers gelagert und transportiert werden können. In den Exportländern wird das LNG dann durch eine Verdampfungsanlage in seinen ursprünglichen gasförmigen Zustand zurückversetzt und in das Gasleitungssystem eingespeist.
Die Anzahl der europäischen Terminals konnte in den vergangenen Jahren zwar deutlich gesteigert werden, und es gibt laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gegenwärtig insgesamt 37 Terminals (26 davon in den EU-Ländern), wobei zusätzlich 27 Terminals in Planung sein sollen. Allerdings verfügt man damit über eine gemeinsame Regasifizierungskapazität von etwa nur 243 Milliarden Kubikmetern pro Jahr – das entspricht mehr als 40 Prozent des jährlichen europäischen Gasbedarfs und immerhin rund 25 Prozent des Bedarfs in der EU. Nicht zu vergessen ist der Auslastungsgrad der Terminals, der in diesem Jahr bei etwa 70 Prozent liegt und damit ungewöhnlich hoch ist. In den Jahren zuvor sollen die Kapazitäten durchschnittlich nicht einmal zur Hälfte ausgelastet gewesen sein.
Und inmitten von alledem gibt es Deutschland, das immer noch kein einziges LNG-Terminal besitzt, weshalb ein direkter Import aus den USA oder dem Nahen Osten für die Bundesrepublik bislang nicht infrage kam. Stattdessen müssen die benötigten Mengen an Erdgas beispielsweise über die Anlagen in Frankreich, Belgien oder den Niederlanden eingeführt und dann in das europäische Gasnetz eingespeist werden.
Dieses Problem hatte schon die vorherige Bundesregierung erkannt und schrieb daher den Aufbau einer LNG-Infrastruktur in Deutschland als Ziel in ihrem Koalitionsvertrag fest. Geplant waren Investitionen in den Bau von LNG-Terminals an den Standorten Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven, allerdings passierte in dieser Frage lange Zeit kaum etwas, weil es bei den Planungen nach Medienangaben keine ausreichenden Rahmenbedingungen für Investitionen gegeben hätte. Medien zufolge stand das im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel geplante Terminal bereits sogar kurz vor dem Aus, nachdem sich der Hauptinvestor von dem Bauvorhaben zurückgezogen und die Stadtverwaltung ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans gestoppt hatte.
Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges hat das neue Bundeskabinett von Kanzler Olaf Scholz jeweils zwei LNG-Projekte in Brunsbüttel und im niedersächsischen Wilhelmshaven sehr schnell vorangebracht. Wie das Portal des Norddeutschen Rundfunks berichtete, wurde in Brunsbüttel am 23. September mit dem Bau der ersten Leitungen für ein schwimmendes LNG-Terminal begonnen, das noch in diesem Winter fertiggestellt werden und ans Netz gehen soll.
In Wilhelmshaven ist laut dem Portal Manager Magazin bereits im Mai mit dem Bau einer Anlage begonnen worden, die im kommenden Dezember in Betrieb gehen soll. Das zweite LNG-Terminal soll ein Jahr später fertiggestellt sein. Den Angaben zufolge werden die bestehenden Anbindungsleitungen eine Kapazität von durchschnittlich mindestens 3,5 Milliarden Kubikmetern pro Schiff und Jahr ermöglichen. Nach Bau und Inbetriebnahme einer neuen Gasleitung könnte die Kapazität ab Ende des kommenden Jahres pro Schiff auf mindestens fünf Milliarden Kubikmeter im Jahr gesteigert werden.
Auch wenn diese Kapazität bei Weitem nicht an das heranreicht, was über die Ostseegasleitung nach Europa transportiert wurde, bleibt es trotzdem abzuwarten, bis diese Anlagen einsatzbereit sind. In der Zeit kann Deutschland nicht an der LNG-Anlandung in Europa mitwirken, und deutsche Energieversorger müssen für die Anlieferung von Flüssiggas weiterhin die Terminals in den Nachbarländern nutzen.
Ukraine-Transit als Risikofaktor
Außerdem bleibt Europa, wie im ersten Teil des Artikels erwähnt, weiterhin noch der Gastransit über die Ukraine. Unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Konkurrenz zwischen der EU und den USA war das Weiße Haus bislang auch stets daran interessiert, die Europäer an diesen postsowjetischen Krisenstaat zu binden, der offenkundig als ein Risikofaktor bei der europäischen Versorgungssicherheit gilt.
Dass der Transport durch die Leitungen des ukrainischen Gastransmissionssystems die Versorgungssicherheit Deutschlands und Europas keinesfalls erhöhen konnte, zeigte sich bereits während des Baus von Nord Stream 1. Ausschlaggebend für die Umsetzung dieses Pipeline-Projekts war der im Zuge der “Orangen Revolution” 2004 durchgesetzte politische Richtungswechsel der Ukraine hin zum Westen sowie der im Jahr darauf folgende und immer noch anhaltende Gasstreit zwischen Kiew und Moskau, bei dem es hauptsächlich um die Höhe der Gebühren für Gastransit nach Europa sowie die jährliche Menge der Durchleitung geht. Für die Europäer bedeutete dieser Konflikt jedoch zahlreiche Lieferunterbrechungen sowie reduzierte Durchleitungsmengen, was in einigen EU-Ländern, wie zum Beispiel im Jahr 2009, zu Versorgungsengpässen und Ausfällen geführt hat.
Ein weiteres Mal eskalierte der Gasstreit nach dem sogenannten Euromaidan 2014, als der russlandfreundliche Präsident Wiktor Janukowitsch das Land verlassen musste und eine prowestliche Regierung in Kiew die Macht übernahm. Als Reaktion darauf wurde zwischen Gazprom und mehreren Energiekonzernen der EU der Bau von Nord Stream 2 beschlossen, um, wie es damals hieß, eine größere Unabhängigkeit von unsicheren Transitländern wie der Ukraine zu erreichen und dadurch die Sicherung der Gasversorgung Europas zu stärken. Dieser Plan ging bis zuletzt nicht und im weiteren Verlauf könnte er, wenn überhaupt, auch nur zur Hälfte umgesetzt werden, weil eine Rohrleitung der Pipeline bei dem Anschlag Ende September zerstört wurde.
Infolge der russischen Militärintervention in der Ukraine hat sich der Gasstreit zwischen den beiden Sowjetrepubliken zudem erneut zuspitzt. Aufgrund von Gebietsverlusten hatte die Kiewer Führung den Transit von russischem Gas nach Europa teilweise gekappt und genehmigte die Durchleitung des Gases daraufhin laut Angaben des Magazins Der Spiegel nur noch an einer Messstation über komplett ukrainisch kontrolliertem Territorium. Die Russen wollen über diese Messstation jedoch nicht mehr Gas in Richtung Europa pumpen, was logischerweise die Reduzierung der Gaslieferungen bedeutet.
Der ukrainische Energiekonzern Naftogaz hatte deswegen Anfang September Klage bei einem schweizerischen Schiedsgericht gegen Gazprom eingereicht, um trotz der geringeren Durchleitung den Transit für die vertraglich vereinbarte maximale Liefermenge zu erhalten. Gazprom lehnt die Forderung ab und will die von der Ukraine nicht geleisteten Dienste nicht bezahlen. Und weil Gazprom auch den Gerichtsstandort ablehnt, weil sich die Schweiz den antirussischen Sanktionen angeschlossen hat, halten Beobachter Sanktionen seitens der Russen bis hin zu einem Lieferstopp in diesem Streit für möglich.
Abgesehen von der Gefahr der Gasknappheit sind auch die ökonomischen Verluste für Verbraucher nicht zu vergessen, die durch Gaslieferstopps verursacht werden. Denn Lieferunterbrechungen wirken sich negativ auf die Preisgestaltung aus. Grundsätzlich wird der Gaspreis für Haushalte wesentlich von den Beschaffungskosten bestimmt, die einem aktuellen BDEW-Bericht zufolge wegen der stark angestiegenen Großhandelspreise für Gas derzeit etwa 60 Prozent des Gesamtpreises ausmachen. Eine direkte Auswirkung auf die Beschaffungskosten haben vor allem die Lieferstopps, weil die Importeure unter hohen Kosten Ersatz beschaffen müssen. Zudem wird der Gaspreis – ungeachtet aller Regeln – von Prognosen, Gerüchten und externen Gründen beeinflusst, die den Spekulanten auf den Märkten in die Hände spielen. So können selbst kurze Lieferunterbrechungen einen enormen Einfluss auf die Preisgestaltung haben, wie die Eskalation des russisch-ukrainischen Gasstreits im Jahr 2009 gezeigt hat.
Insofern bleibt zu konstatieren, dass aufgrund der Ausschaltung der Nord-Stream-Pipelines und der anhaltenden Abhängigkeit Europas von dem problematischen Gastransit durch die Ukraine eine sichere und ökonomisch vertretbare Gasversorgung der EU nicht mehr gewährleistet werden kann.
Mehr zum Thema – Die EU verurteilt sich selbst zur Deindustrialisierung