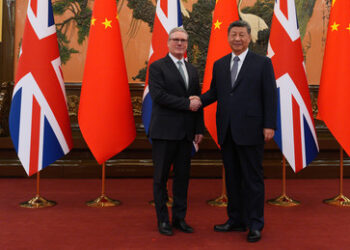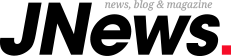Von Dagmar Henn
Der Haushalt für das laufende Jahr ist noch nicht verabschiedet, der für das kommende schleicht sich jetzt schon mit mehreren Löchern in die Debatte, und vom Bürgergeld bis zur Rente werden die Bürger mit den verschiedensten Kürzungsvorschlägen auf Einschnitte eingestimmt. Schließlich muss das Geld da sein für Aufrüstung und Krieg, ganz zu schweigen von einem sich anbahnenden französischen Staatsbankrott. Da überrascht es nicht sonderlich, dass in dieser gesamten Kakophonie jetzt auch Stimmen zu hören sind, die eine Verkleinerung der öffentlichen Beschäftigung verlangen.
Dazu gibt es also jetzt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft über “Effizienz der öffentlichen Beschäftigung von Ländern und Kommunen”, und begleitend äußert der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, seiner Meinung nach bräuchte es Beamte nur “bei der Polizei, der Feuerwehr oder in anderen Sicherheitsbereichen, bei Finanzbeamten oder beim Zoll”. Der übliche Vorwurf: Öffentliche Beschäftigung sei ineffizient.
Linnemann zielt vor allem auf die Lehrer: Diese sind der größte noch verbliebene Brocken an Beamten, seit schon vor Jahrzehnten Post und Bahn aus dem öffentlichen Dienst verschwanden. Nicht, dass die Bahn seither besser funktioniert, im Gegenteil, von einer weltweit legendären Pünktlichkeit hat sich der nach wie vor im staatlichen Eigentum befindliche, aber nach privatwirtschaftlichen Kriterien gelenkte Konzern auf eine der schlechtesten Positionen in Europa herabgearbeitet ‒ aber es sind eben keine Beamten mehr, und auch im Postbereich gibt es inzwischen ganz viele private Zusteller, zumindest bei Paketen, die alle Gewinn machen wollen und ihr Personal entsprechend schlecht bezahlen.
Die Lehrer – das sind immerhin etwa eine halbe Million bei den Bundesländern beschäftigte Beamte, also mehr als ein Viertel aller 1,7 Millionen Beamten in Deutschland – haben inzwischen fast noch einmal so viele Kollegen, die nicht verbeamtet, sondern angestellt sind. Aber es gibt genug Erfahrungswerte, die deutlich dafür sprechen, die Lehrer lieber zu verbeamten. Einer der ersten Aspekte, der darunter leidet, wenn Lehrer, wie in vielen Bundesländern Mode, vom ersten bis zum letzten Schultag beschäftigt werden und dann über die Sommerferien arbeitslos sind, ist die Beziehung zu den Eltern, die aber mit dem extrem gewachsenen Anteil von Migrantenkindern aufwendiger und wichtiger wird. In der Debatte wird jedoch immer so getan, als seien die mangelhaften Ergebnisse des Bildungsapparats und der Beschäftigungsstatus der Lehrer Dinge, die nichts miteinander zu tun hätten. Weshalb man dann am einen Tag Einsparungen durch weniger Verbeamtungen fordern kann, um am nächsten zu beklagen, dass zu viele Schüler zu schlecht gebildet sind… Abgesehen davon, dass auch die Bereitschaft, selbst Kinder zu bekommen, bei unsicheren Beschäftigungsverhältnissen deutlich zurückgeht. Aber dafür gibt es ja den Fertigmenschimport.
In etwa auf die gleiche Weise blickt auch der IW-Report auf die öffentlichen Beschäftigten vor allem in den Kommunen. Es wird zwar erwähnt, dass der Zuwachs im Bereich Soziales und Jugend etwas mit dem Ausbau der Kinderbetreuung zu tun haben könnte, aber im Vergleich, der zwischen den Kommunen angestellt wird, werden entscheidende Entwicklungen einfach übersehen. So etwa, dass eine Kommune, die unter Haushaltsaufsicht steht und Schwierigkeiten hat, die Pflichtaufgaben zu bewältigen, letztlich immer aus einer Unterversorgung heraus agiert und die Kräfte, die sie womöglich bräuchte, gar nicht einstellen kann. Tatsächlich sind ‒ und das gilt auch für die Kinderbetreuung ‒ die meisten Aufgaben, die bei den Kommunen hinzukommen, kein Beschluss der kommunalen Ebene, sondern eine Vorgabe, die in der Bundes- oder Landespolitik getroffen wird.
Bei der Kinderbetreuung beispielsweise schuf die Bundespolitik einen Rechtsanspruch erst auf einen Kindergarten-, dann auf einen Krippenplatz, aber die Kommunen müssen diese Entscheidung umsetzen. Die Landespolitik bestimmt in der Regel den Personalschlüssel, aber die Kommune muss das Personal einstellen. 2023 teilte der Städte- und Gemeindebund NRW mit, 38,5 Prozent der Städte und Gemeinden gingen davon aus, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.
Man unterscheidet bei Kommunen zwischen originär kommunalen Aufgaben (wie der Unterbringung von Obdachlosen) und Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, wie das Meldewesen, die im Auftrag von Bund oder Land erfüllt werden. Eigentlich müssten die Kosten, die durch diese übertragenen Aufgaben entstehen, vollständig ersetzt werden. In Wirklichkeit hinkt die Erstattung einer neuen Aufgabe immer um mehrere Jahre hinterher. Dann gibt es noch eine dritte Kategorie ‒ das sind die freiwilligen Leistungen. Die gibt es immer nur dann, wenn die Kommune nach Erledigung der verpflichtenden Aufgaben noch Geld übrig hat. In diese Kategorie fällt so gut wie alles, was die Lebensqualität der Bürger bestimmt, von der Taktdichte des öffentlichen Nahverkehrs über Schwimmbäder und Bibliotheken bis zur Funktionsfähigkeit des Winterdienstes.
Wenn die kommunalen Mittel im Grunde nicht ausreichen, um die erforderlichen Aufgaben zu erfüllen, wird in der Umsetzung gestreckt. Das heißt dann beispielsweise, es werden zwar ordnungsgemäß Anträge auf Pässe und Personalausweise entgegengenommen, aber nur noch in halbierten Bürozeiten, und Bearbeitungszeiten für alles, das keine engen Zeitvorgaben hat, werden gedehnt. Das ist, neben den irrwitzigen bürokratischen Anforderungen, einer der Gründe, warum die Bearbeitung von Wohngeld in der Regel sehr lange dauert, gern mal ein halbes Jahr ‒ das sind keine kommunalen Mittel, die Stadt spart damit auch nichts, aber sie muss das Personal halten, das die Anträge bearbeitet. Sobald es auch nur ansatzweise finanziell eng wird, sind das die ersten Stellen, die dran sind. Verwaltungsbeschäftigte kann man nämlich gelegentlich einfach hin- und herschieben, zumindest in größeren Verwaltungen.
An anderen Stellen ist das schwieriger, und dort lässt sich auch erkennen, warum die Vorstellung von Effizienz, die das IW entwickelt, nicht wirklich sinnvoll ist. Nehmen wir die Baubehörde. Die ist unter anderem dafür verantwortlich, Baugenehmigungen zu erteilen. Dafür braucht es entsprechend qualifiziertes Personal, das die eingereichten Pläne entsprechend beurteilen kann. Das aber an diesen Positionen vergleichsweise schlecht verdient. Und da im Gegensatz zu früher, als die städtischen Bauämter auch selbst bauten, es an den wenigsten Orten überhaupt noch möglich ist, mal in eine Abteilung zu kommen, in der gebaut wird, ist das für Bauingenieure kein sonderlich attraktiver Job. Weil es ohnehin wenige davon gibt, weil die Bautätigkeit in Deutschland insgesamt in den letzten drei Jahrzehnten verglichen mit anderen europäischen Ländern niedrig war, können die, die es gibt, sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Im Zusammenhang mit den Arbeiten, die jetzt an der Infrastruktur geplant sind (die teilweise schon vor zwanzig Jahren in kritischem Zustand war, insbesondere bei den Brücken), stellt sich jetzt heraus, dass nicht einmal die Bauanträge dafür bearbeitet werden können…
Das Problem: Die Vorgabe, stets nur maximal so viel Personal zu halten, wie im jeweiligen Augenblick für die Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist, führt in die Irre. Denn die Bauanträge sind dem tatsächlichen Bau vorgelagert, was heißt, ihre Zahl kann überraschend ab- und zunehmen, weil alles Weitere, an dem sich dann die Baukonjunktur bemisst, bis hin zur Zahl fertiggestellter Gebäude, danach kommt. Wenn an diesem Punkt ein Engpass ist, setzt sich das unmittelbar in eine geringere Produktion um, weil es zur Genehmigung durch die zuständige Behörde auch keine Alternative gibt. Das bedeutet, sobald es im Apparat keine Redundanz gibt, stranguliert das die reale Entwicklung im Ansatz. Die Folgeschäden sind für die Gesellschaft weit teurer als die Personalkosten, die die erforderliche Redundanz auslöst. Aber sie fallen an einem anderen Ort an und werden deshalb bei einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung nicht mit eingerechnet.
Wenn man nun den Zuwachs betrachtet, den die IW-Studie bei der Kinderbetreuung feststellt ‒ die tatsächlichen Daten besagen, dass dieser Zuwachs nach wie vor nicht genügt, weil im Grunde die Aufgabe durch die Zuwanderung um vieles schwieriger geworden ist. Und nach wie vor erweist sich nicht einmal der Anspruch auf einen Kindergartenplatz überall als erfüllbar. Wobei es da eben durchaus eine Rolle spielt, ob eine Kommune unter Haushaltsaufsicht steht oder nicht ‒ ebenso, wie es eine Rolle spielt, mit welchem Blick auf die Landesfinanzen die Betreuungsschlüssel festgelegt werden. Aber die Kosten, die letzten Endes durch das Scheitern im Bereich der frühkindlichen Bildung ausgelöst werden, schlagen erst über ein Jahrzehnt danach zu Buch, dann womöglich vor einer großen Strafkammer.
Übrigens, neben den bürokratischen Vorschriften, die vor allem Brüssel mit Leidenschaft produziert, und dem zusätzlichen Verwaltungsaufwand, den auch die Umstellung auf doppelte Buchführung generiert (ganz abgesehen von der Begierde des Apparats selbst nach vermeintlich objektivierbaren Lenkungsinformationen), ist es auch der politische Prozess, der mehr Zeit für die Erstellung von Daten erzwingt. Je stärker die Neigung der Mehrheit, Anträge der Minderheit pauschal zu übergehen, desto stärker wird auch das Bedürfnis, dies mit Fakten zu kontern, die aber erst von der Verwaltung erfasst und verarbeitet werden müssen. Man passt sich in der Opposition natürlich an diese Lage an und beginnt jeden Ansatz zu einer politischen Bemühung in eine bestimmte Richtung mit Anfragen, um sich die Daten zu beschaffen, die zur Untermauerung der eigenen Argumentation nötig sind. Je formalisierter die kommunale Politik betrieben wird, je stärker sie dem parlamentarischen Betrieb auf Landes- und Bundesebene ähnelt, desto größer wird dieser Informationsaufwand, der letztlich nur Munitionsbeschaffung ist.
Auch das sind Prozesse, die dem IW fremd sind. Schon grundsätzlich, weil der zentrale Glaube der Betriebswirtschaft darin besteht, dass sich aus der buchhalterischen Wahrheit alles gewinnen lässt, was für die richtige Entscheidung nötig ist. Eine Kommune, ja, überhaupt ein politischer Organismus gleich welcher Ebene, hat aber nicht diese einfache Steuerinformation, die der Gewinn als absolutes Ziel der Tätigkeit darstellt.
Das Ziel einer Stadtverwaltung ist nicht die Erzielung eines Überschusses. Das Ziel ist eine funktionierende Stadtgesellschaft. Weshalb man sich bei jedem Einsatz betriebswirtschaftlicher Techniken (und die ganze Nummer, die das IW da abzieht, mit Benchmarking etc., ist betriebswirtschaftlich) darüber im Klaren sein muss, dass sich viele Informationen, die für eine richtige Entscheidung erforderlich sind, diesen Techniken entziehen. Langfristig ist es nicht der Wert, der in einem abstrakten Vergleich des Wachstums der öffentlichen Beschäftigung errechnet wird, der über das Wohl und Wehe einer Stadt entscheidet, sondern, ob ihre Bewohner eine Arbeit finden, eine Wohnung, und ‒ ob sie sich in ihr wohl fühlen.
Und dieses Wohlfühlen wird oft von Faktoren beeinflusst, die ganz und gar nicht betriebswirtschaftlich sind. Wenn eine Stadt die Straßenbeleuchtung reduziert, um Geld zu sparen, beeinträchtigt dies das Sicherheitsgefühl der Bewohner unter Umständen erheblich. Es kann aber auch nach einer gewissen Zeit die reale Sicherheit beeinflussen. In welchem Verhältnis steht das zur Einsparung durch weniger Beleuchtung? Wenn an der Straßenreinigung gespart wird, welchen Einfluss hat das nicht nur auf die Wahrnehmung, sondern auch auf das Verhalten?
Ja, es gibt immer wieder auffällige Geniestreiche. Das “Bildungs- und Teilhabepaket” beispielsweise, das einer gewissen Ursula von der Leyen aus ihrer Zeit als Familienministerin zu verdanken ist, ist ein Antragsmonster, dem es problemlos gelingt, höhere Verwaltungskosten zu erzeugen, als zuletzt überhaupt an Förderung ausgereicht wird. Das schafft nicht jeder, aber von der Leyen schaffte das. Nun ist es aber einmal da, und das bürokratische Ungeheuer lebt weiter, weil der politische Wille fehlt, hier zu einem vernünftigeren Umgang zu kommen. Wie die Dame das damals erklärte, die Armen könnten sich ja sonst Zigaretten und Alkohol kaufen, wenn man ihnen das Geld gäbe.
Übrigens, in den Berichten im Zusammenhang mit zehn Jahren “Wir schaffen das” kam auch heraus, warum die Ukrainer, die im Jahr 2022 nach Deutschland kamen, gleich im Bürgergeld landeten. Der Grund war, dass die Bearbeitung derart vieler Asylanträge die vorhandenen Möglichkeiten gesprengt hätte. Und die Bearbeitungskosten wären sichtbarer gewesen ‒ beim Bürgergeld verschwanden sie im Gesamtaufwand der Arbeitsagentur, und landeten außerdem noch auf dem Konto der Beitragszahler.
Das Ergebnis der IW-Studie ist dann übrigens die Behauptung, man könne bundesweit 60.000 Vollzeitäquivalente einsparen, in Kommunen und Ländern, und damit 3,4 Milliarden Euro jährlich sparen. Das entspricht dann weniger als der Hälfte dessen, was so ein bundesdeutscher Politiker als Mitbringsel bei Selenskij lässt. Oder etwas weniger als einem Dreihundertstel, 0,294 Prozent der Billionenschuld, die der alte Bundestag noch beschlossen hat. Oder ‒ es lassen sich viele Beispiele finden. Und das Schlimmste ‒ zumindest für viele Kommunen wäre damit gar nichts gewonnen, da sie mitnichten dadurch Geld für andere Dinge frei verfügbar hätten, sondern nur ein anderes Loch damit stopfen.
Aber es hilft mit, ein Klima zu schaffen, in dem von Verschwendung die Rede ist, wenn tatsächlich an jeder Ecke zu sehen ist, wie gründlich kaputtgespart wurde. Und es bekräftigt noch einmal diese eigenartige Vorstellung von Effizienz, deren Sinn jeder Deutsche problemlos durch den Gebrauch der Deutschen Bahn überprüfen kann.
Mehr zum Thema ‒ Der Koalitionsvertrag: Aberglauben rund um den Amtsschimmel (Teil IV)