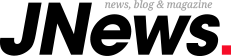-
10.11.2022 16:52 Uhr
16:52 Uhr
Internationale Transportunternehmen warnen vor schwerer Rezession

Containerschiff vor Hamburg, 09. Juni 2022Jonas Walzberg / www.globallookpress.com In wirtschaftlichen Abläufen gibt es “vorlaufende” und “nachlaufende” Daten. Umsätze auf Rohstoffmärkten und bei Transportunternehmen zeigen bereits Entwicklungen an, noch ehe sie sich in Produktion und Handel manifestieren.
Zwei Giganten des internationalen Transportgewerbes, das US-Transportunternehmen FedEx und die dänische Großreederei Maersk, haben ihre Tätigkeit deutlich zurückgefahren.
FedEx, das vor allem im Luftfrachtverkehr tätig ist, hat die Zahl seiner Flüge reduziert und Flugzeuge geparkt. Der Finanzvorstand des Unternehmens, Michael Lenz, erklärte am Dienstag:
“Wir haben etwa 8 oder 9 internationale Linien und etwa 23 heimische Linien bisher, mit der Änderung des Flugplans im Oktober, eingestellt. Weitere 8 oder 9 heimische Linien werden im November folgen.”
Im September hatte FedEx bereits seine Umsatzvorhersagen für 2022 zurückgezogen. Der Vorstandsvorsitzende, Raj Subramaniam, trat inzwischen sogar im US-Fernsehen auf und warnte vor einer globalen Rezession.
Aber nicht nur FedEx stellt Linien ein. Auch die Reederei Maersk, ein Gigant der Containerschifffahrt, hat ihre Vorhersagen für 2022 gesenkt und erwartet für 2023 schlechtere Umsätze. Grund dafür ist vor allem der Rückgang der Kaufkraft, der wiederum die Nachfrage nach Transportkapazitäten senkt.
Noch im vergangenen Sommer war die Nachfrage nach Containerschiffen höher als das Angebot; Häfen in den USA und in Europa kamen gar nicht mehr nach, die Schiffe zu entladen.
Die Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) hat die Zentralbanken bereits gewarnt, die aggressiven Zinserhöhungen könnten eine Wirtschaftskrise auslösen. Die augenblicklichen Anzeichen der Rezession sind allerdings noch keine direkte Folge dieser Zinserhöhungen; es dauert in der Regel neun Monate bis zu einem ganzen Jahr, ehe solche Zinserhöhungen wirtschaftliche Folgen zeigen. Das heißt, sie werden sich erst im Lauf des Jahres 2023 bemerkbar machen, zusätzlich zu dem Rückgang in der Produktion, der bereits jetzt stattgefunden hat.
-
9.11.2022 21:17 Uhr
21:17 Uhr
Versteigerung von US-Staatsanleihen belegt Skepsis
Am 9. November fand eine Versteigerung von US-Staatsschulden statt, die sehr schlecht verlief. In letzter Zeit waren bereits britische und auch deutsche Staatsanleihen schwer verkäuflich. Hierzulande traf es die siebenjährigen Schatzbriefe, die die von der Regierung geplanten Energiezuschüsse finanzieren sollen.
Die Versteigerung in den USA überraschte deshalb, weil am Tag zuvor dreijährige Anleihen problemlos angenommen wurden. Bei solchen Versteigerungen werden die Gebote vorab mit der Verzinsung, die man erwartet, abgegeben. Verteilt werden sie dann in der aufsteigenden Reihenfolge der Gebote, beginnend beim niedrigsten Zinssatz. Der Zins wird also nicht vom Anbieter festgelegt, sondern ergibt sich aus den Geboten.
Eine weitere wichtige Information ist, wie weit das Gebot das Angebot übersteigt, und wie stark der Zins, zu dem der letzte Anteil verkauft wurde, über dem Zins liegt, zu dem der erste Anteil vergeben wurde.
Die Zinsen dieser letzten Versteigerung lagen mit 4,14 Prozent deutlich über den 3,93 Prozent des vergangenen Monats und damit auf dem höchsten Wert seit der Lehman-Pleite im Jahr 2008. Der Unterschied zwischen dem Beginn und dem Ende der Versteigerung lag bei 0,034 Prozent, was der größte Abstand seit 2016 ist. Die Gebote betrugen das 2,23-Fache des versteigerten Volumens, was ebenfalls der niedrigste Wert seit August 2019 ist.
Die wichtigste Information ist allerdings der Unterschied zwischen der Versteigerung der zehnjährigen und der davor abgehaltenen, völlig unauffälligen Versteigerung der dreijährigen Staatsanleihen. Denn dieser Unterschied deutet an, dass zwar kurzfristig noch Vertrauen, langfristig aber Zweifel an der wirtschaftlichen Zukunft der Vereinigten Staaten besteht.
-
19:49 Uhr
Deutliches Auftragsminus der Industrie im September
Deutschlands Industrie hat im September einen Auftragseinbruch erlitten. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, gingen die Bestellungen um 4,0 Prozent zurück. Laut Reuters hatten Ökonomen lediglich mit einem Auftragsrückgang von 0,5 Prozent gerechnet, nach einem Minus von 2,0 Prozent im August. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag das Auftragsminus sogar bei 10,8 Prozent, allerdings war das Auftragsvolumen im September 2021 durch “Nachholeffekte” der Corona-Krise bei einer gleichzeitigen Knappheit von Vorprodukten deutlich größer gewesen.
Wie das Bundeswirtschaftsministerium hinzufügte, scheint der Nachholeffekt nach der Corona-Krise beendet zu sein. Der Rückgang der Aufträge war dem Ministerium zufolge vor allem auf einen Einbruch der Auslandsnachfrage zurückzuführen. Im Inland lagen die Aufträge zwar noch leicht im Plus, allerdings sank die Nachfrage aus dem Ausland um 6,3 Prozent im Nicht-Euro-Raum und um 8,0 Prozent im Euro-Raum.
Am stärksten betroffen waren die Industriezweige Kraftfahrzeuge (-9,0 Prozent) und Maschinenbau (-8,1 Prozent). Die schlechte Weltkonjunktur und vor allem die Energiekrise setzen der Industrie derzeit zu, wie auch eine kürzlich erschienene Firmenumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zeigte.
-
17:32 Uhr
Banken: Geschäft mit Immobilienkrediten bricht ein

Symbolbildwww.globallookpress.com Trotz der bereits deutlich gestiegenen Preise für Baumaterialien lag das Geschäft der Banken mit Immobilienkrediten noch im März auf Rekordhöhe; für 32 Milliarden Euro wurden neue Kredite vergeben. Aber schon im August machten sich die Zinserhöhungen bemerkbar und das Volumen fiel auf 18,5 Milliarden. Im September waren es dann nur noch 16,1 Milliarden, der niedrigste Stand seit 2014.
Die Bauunternehmen hatten bereits vor Monaten über eine steigende Zahl zurückgezogener Bauaufträge berichtet, aber noch halten sich die meisten mit bereits abgeschlossenen Aufträgen. Die Entwicklung bei der Kreditvergabe zeigt an, welche Bauaufträge gar nicht erst erteilt werden. Aber es wird noch einige Monate dauern, bis sich das als fehlende Bautätigkeit bemerkbar macht.
Immobilienkredite an Privatleute und Selbständige machen 40 Prozent des gesamten Kreditvolumens aus. Vermutlich angesichts von Inflation und Zinsraten, die sich im Verlauf des Jahres für zehnjährige Immobilienkredite vervierfacht hatten, hatten zuletzt sowohl mögliche Kunden als auch die Banken deutlich vorsichtiger kalkuliert. Viele Kunden dürften einen geplanten Bau oder Kauf zumindest verschoben haben.
Der gegenwärtige Tiefstand wird aber noch nicht das Ende der Entwicklung darstellen. Nachdem die US-Notenbank vor wenigen Tagen ihren Leitzins um weitere 75 Basispunkte erhöht hat, steht demnächst eine entsprechende Erhöhung der EZB ins Haus. Womit sich dann diese Kreditzinsen binnen eines Jahres verfünffacht hätten.
Für die Bauwirtschaft sind das schlechte Aussichten. Aber auch für die Banken, vor allem für besonders stark in diesem Bereich engagierte Sparkassen, könnte das zu einem größeren Problem werden. Denn zu den Einbrüchen bei neu vergebenen Krediten, die die Erträge schrumpfen lassen, kommen aller Wahrscheinlichkeit nach steigende Zahlen notleidender Bestandskredite durch die extremen Energiekosten. Und in manchen Regionen sind erste Anzeichen eines Platzens der Immobilienblase zu erkennen, was dazu führen könnte, dass dann der Wert der Kredite den Wert der Immobilie übersteigt. Gleichzeitig greifen immer mehr Deutsche ihre Reserven an, wodurch die Einlagen zurückgehen.
-
8.11.2022 22:20 Uhr
22:20 Uhr
Uniper und NewMed Energy planen Gasexport aus Israel nach Europa
Uniper und NewMed Energie erwägen, Flüssigerdgas aus Israel nach Europa zu exportieren. Wie Uniper am Dienstag in Düsseldorf berichtete, sei zur Sondierung von Kooperationsmöglichkeiten bei der Lieferung von Erdgas nach Europa und der Entwicklung von blauem Wasserstoff (Wasserstoff, der durch die Spaltung von Erdgas gewonnen wird) eine Absichtserklärung unterzeichnet worden.
Beide Unternehmen wollen zudem die kurzfristige Lieferung von Erdgas über die Pipeline zwischen Israel und Ägypten prüfen, um Gas über LNG-Terminals nach Deutschland zu bringen. Darüber hinaus planen beide eine langfristige Kooperation bei der Lieferung von LNG aus der Leviathan-Lagerstätte, Israels größter Erdgas-Lieferstätte im Mittelmeer.
-
21:37 Uhr
Automobilzulieferer Schaeffler baut 1.300 Stellen ab

Daniel Karmann/dpa / www.globallookpress.com Der Automobilzulieferer Schaeffler baut weltweit 1.300 seiner 83.000 Stellen ab, davon 1.000 in Deutschland. Als Grund dafür gab das Unternehmen die schneller als erwartet voranschreitenden Transformation der Branche weg vom Verbrenner und hin zur Elektromobilität an. Bereits 2020 hatte der Konzern den Abbau von 4.400 Stellen bekannt gegeben, Werkschließungen sind diesmal allerdings nicht vorgesehen.
Von den Stellenstreichungen, die bis 2026 erfolgen sollen, sind vor allem die Standorte Herzogenaurach, Bühl in Baden und Homburg an der Saar betroffen. Bemerkenswerterweise betrifft der Stellenabbau vor allem den Bereich Forschung und Entwicklung, drei Viertel des Stellenabbaus entfallen auf diesen Bereich. Demnach sollen vor allem Stellen im Bereich Forschung und Entwicklung von Teilen für Verbrennerantriebe oder aus Zentralfunktionen gestrichen werden.
-
21:09 Uhr
Möglicher Lieferstopp von Vitol – Weitere Milliardenverluste drohen
Dem deutschen Steuerzahler droht ein weiterer Milliardenverlust: Grund dafür ist ein drohender Lieferstopp des Rohstoffhändlers Vitol, von dem die frühere Gazprom-Tochter Gazprom Germania (heute: Sefe, unter Treuhandschaft des Bundes) betroffen wäre. Sefe ist mit einem Eilantrag vor einem Londoner Gericht gescheitert, mit dem das Unternehmen Vitol daran hatte hindern wollen, die Gaslieferungen bereits nächste Woche einzustellen.
Informierten Kreisen zufolge drohen Sefe Verluste in Höhe von rund einer Milliarde Euro, wenn das Unternehmen das Gas zu höheren Marktpreisen ersetzen muss. Da die ehemalige Gazprom-Tochter mit einer Kreditlinie von 11,8 Milliarden Euro über die Staatsbank KfW gestützt wird, bedeuten die möglichen Verluste ein weiteres Risiko für den deutschen Steuerzahler. Vitol hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 4,2 Milliarden US-Dollar eingefahren.
Wie aus dem Gerichtsbeschluss hervorgeht, hatte Sefe gebeten, Vitol per einstweiliger Verfügung an Maßnahmen zu hindern, die “unmittelbare und irreparabel schädliche Folgen” haben könnten. Vitol hingegen argumentiert, man sei dazu berechtigt, die Lieferungen jederzeit zu beenden, da Sefe im April den Eigentümer gewechselt hat.
-
19:38 Uhr
Ifo-Institut: Anstieg der Energiepreise kostet Deutschland fast 110 Milliarden Euro

Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-KonjunkturprognosenStefan Boness/Ipon / www.globallookpress.com Durch die rasant gestiegenen Energiepreise gehen der deutschen Volkswirtschaft Milliarden Euro verloren. Zusammengenommen kostet der Energiepreis-Schock nach Berechnungen des Ifo-Instituts Deutschland knapp 110 Milliarden Euro, was etwa drei Prozent der Wirtschaftsleistung eines Jahres entspricht. Wie der Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen Timo Wollmershäuser erklärte, sei der wirtschaftliche Verlust nur während der zweiten Ölkrise von 1979 bis 1981 mit vier Prozent höher gewesen.
Die entsprechenden gesamtwirtschaftlichen Verluste hätten erst fünf Jahre später wieder ausgeglichen werden können. Damals sanken die Ölpreise deutlich. Zudem wertete die D-Mark spürbar zum US-Dollar auf, was Energieimporte billiger machte. Wollmershäuser erwartet daher, dass sich die Situation nicht so schnell entspannen wird:
“Der derzeitige Realeinkommensrückgang dürfte auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Zum einen werden die Energiepreise mit dem Wegfall Russlands als Lieferant wohl dauerhaft hoch bleiben. Zum anderen wird sich an der Abhängigkeit Deutschlands von importierter Energie so schnell nichts ändern.”
Das Ifo-Institut veröffentlichte seine Berechnungen vor dem Hintergrund der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Den Ökonomen zufolge werde daher bei Tarif- und Gehaltsverhandlungen entsprechend weniger an Arbeitnehmer zu verteilen sein.
-
7.11.2022 21:03 Uhr
21:03 Uhr
Einzelhandel sorgt sich um Weihnachtsgeschäft

Symbolbildwww.imago-images.de / www.globallookpress.com Nicht einmal zwei Monate vor dem Weihnachtsfest ist die Stimmung im Einzelhandel auf einem Tiefstand. Wie aus dem Index des Handelsverbandes hervorgeht, war die Stimmung nur im Vormonat schlechter. Die Lage ist seit Beginn der Branchenaufzeichnungen die schlechteste seit Jahren. Die Verkäufer hoffen zwar auf eine Rückkehr der Kunden vor Weihnachten, doch die stark gestiegenen Preise nehmen den Menschen die Lust auf einen Einkaufsbummel.
Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts berichtet fast die Hälfte der befragten Einzelhändler im Oktober von weniger Kunden als noch im Juli. Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, erklärte, dass sich gerade einkommensschwache Menschen wegen der hohen Inflation weniger leisten können und mit Einkäufen zurückhaltend sind. Aber nicht nur der zurückhaltende Konsum der Kunden ist ein Problem: Drei Viertel der Händler kämpfen laut Ifo immer noch mit Lieferengpässen. Am stärksten sei der Lebensmitteleinzelhandel betroffen: 90 Prozent der Befragten berichteten von Problemen. Bei den Baumärkten bekämen 86 Prozent nicht alle bestellten Waren und auch Spielzeughersteller zeigen sich besorgt, da 63 Prozent nicht das volle Sortiment anbieten können. Am stärksten spüren allerdings Möbelhäuser die Krise: 80 Prozent der befragten Unternehmen berichteten davon, dass weniger Kunden kamen.
Der Handelsverband versucht, das Ganze positiv zu sehen, und verweist auf einen leichten Anstieg. Der monatelange Abwärtstrend der Verbraucherstimmung halte nicht mehr an, Umfragen zufolge sind die Menschen etwas optimistischer als zuletzt. Entsprechend vorsichtig fällt das Urteil des Handelsverbandes aus:
“Von Optimismus kann noch keine Rede sein. Ob die Kaufzurückhaltung zum Weihnachtsgeschäft anhält, werden die kommenden Wochen zeigen.”
Im Fall einer Rezession dürfte sich der Konsum demnach weiter abschwächen.
-
18:42 Uhr
LNG-Schiffe warten vor der Küste Westeuropas auf Preissteigerungen bei Gas

Ein LNG-Tankschiff vor Teneriffa (Symbolbild)Michael Weber/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Vor den Häfen Westeuropas dümpelt eine Flotte von mehr als 30 LNG-Tanker vor sich hin. Doch diesmal sind nicht etwa unzureichende Entladekapazitäten in den Häfen von Rotterdam oder an der französischen und spanischen Küste der Grund für den Stau. Wie die Londoner Energiemarkt-Firma Vortexa vermutet, warten die Gashändler für ihre Lieferungen, die zum Großteil aus den USA, Australien und Katar stammen, auf bessere Preise. Dementsprechend wiesen sie offenbar die Reedereien an, das Transporttempo deutlich zu drosseln. Dem Ortungsportal “Vesselfinder” zufolge fahren die Schiffe mit drei bis acht Knoten, also nicht einmal mit halber Kraft. Zuvor hatte das Handelsblatt darüber berichtet.
Mit der derzeit zurückgehaltenen Menge an Flüssiggas könnte man sämtliche Haushalte des Saarlandes mehr als fünf Jahre mit Energie versorgen. Nach Berechnungen des Handelsblatts beträgt der derzeitige Wert des zurückgehaltenen Flüssiggases rund 3,4 Milliarden US-Dollar – doch den Gashändlern ist der entsprechende Gewinn offensichtlich nicht hoch genug.
Das Kalkül der Händler: Wenn die Ladung erst im Dezember oder Januar gelöscht wird, könnten die Abnehmer in Europa bereit sein, höhere Preise zu zahlen. Nach dem Rekordhoch zu Beginn des Herbstes sind die Preise für Gas auf dem Spotmarkt deutlich gesunken, die Gasspeicher zahlreicher EU-Länder sind derzeit fast vollständig gefüllt. Analysten gehen für die Monate Dezember und Januar allerdings von Preissteigerungen im Bereich von mindestens sechs Prozent aus. Pro Schiff entspräche dies einem Zusatzerlös von knapp sieben Milliarden US-Dollar. Auf dem Markt mit Terminkontrakten winken potenziell sogar 30 bis 35 Prozent höhere Preise für die Monate Dezember und Januar.
Für die Händler könnte sich das Warten finanziell also lohnen – allerdings auch nur dann, wenn sie im Sommer günstige Charterraten für die Schiffe aushandeln konnten. Denn die Mietkosten für LNG-Schiffe sind durch die steigende Nachfrage nach Flüssiggas ebenfalls deutlich gestiegen. Für den Winter sind zudem wenige bis keine LNG-Schiffe mehr zu bekommen, was vor allem asiatische Länder zu spüren bekommen. Viele Händler liefern daher nicht mehr nach Asien. Der Stau vor der westeuropäischen Küste dürfte also andauern.
Krisen- und Insolvenzticker: Internationale Transportunternehmen warnen vor schwerer Rezession
Die deutsche Wirtschaft rutscht immer tiefer in die Krise. Unter dem Druck dramatisch steigender Energiekosten und anderer ungünstiger Rahmenbedingungen sind allein in diesem Jahr tausende Unternehmen insolvent gegangen. Wir fassen in diesem Ticker die wichtigsten Entwicklungen und Neuigkeiten zusammen.