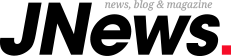von Hans-Ueli Läppli
Die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole markiert eine Zäsur. Zum letzten Mal trat der Vorsitzende der US-Notenbank als unabhängiger Akteur auf.
Unter dem Druck des Weissen Hauses kündigte er eine Zinssenkung an – der Schritt, den Präsident Donald Trump seit Monaten forderte. Powell, der im Mai 2026 zurücktreten wird, ist ab sofort ein “lame duck”.
Die Finanzmärkte reagierten zunächst mit Begeisterung. Der Dow Jones sprang um fast 800 Punkte, Kryptowährungen erreichten neue Höchststände. Doch hinter der Euphorie verbirgt sich eine unbequeme Wahrheit: Zinssenkungen am Ende eines Konjunkturzyklus gelten selten als Aufbruchsignal, sondern eher als Vorboten einer Korrektur.
Powell selbst begründete seinen Schritt mit einer abflauenden Inflation, doch für viele Analysten kommt die Kehrtwende zu spät.
Trump nutzt die Lage politisch geschickt: Einst hatte er Powell selbst ins Amt gebracht, später ihn als Bremser und Gegner gebrandmarkt. Nun reklamiert er den Sieg – und hat zugleich den Sündenbock parat, falls die Märkte ins Rutschen geraten. In seiner Lesart trägt allein Powell die Schuld für den Crash, weil er die Zinsen nicht rechtzeitig gesenkt habe.
Das Klima im Zentralbankrat verschärft sich. Trump attackiert offen einzelne Gouverneure, zuletzt Lisa Cook, deren Rücktritt er forderte. Damit rüttelt er an den Grundfesten der Fed-Unabhängigkeit. Gleichzeitig verschlechtert sich die ökonomische Grosswetterlage: Inflation und Arbeitslosigkeit steigen erneut, während Trumps Zollpolitik erst mit Verzögerung ihre volle Wirkung entfalten wird. Spätestens zum Jahresende, wenn Importpreise explodieren und Konsumenten höhere Kosten schultern müssen, droht der boomerangartige Rückschlag.
Powells Schwenk wirkt deshalb weniger wie ein Befreiungsschlag, sondern wie ein Signal der Schwäche. Er war der letzte Fed-Chef, der ernsthaft versuchte, politische Einflussnahme abzuwehren. Mit seiner Kapitulation beginnt eine neue Ära, in der die amerikanische Notenbank endgültig zum Instrument der Politik zu werden droht.
Mehr zum Thema – Ursula-Gate: Warum auch hochkorruptes Verhalten der EU-Kommissionspräsidentin nicht schadet