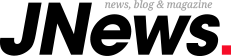Von Olga Samofalowa
US-Präsident Donald Trump hat unerwartet ein “großzügiges Geschenk” an ein kleines europäisches Land gemacht – Ungarn: Er hat Budapest erlaubt, russisches Öl über die Druschba-Ölpipeline und russisches Gas über die Turkish-Stream-Gaspipeline zu erwerben. Mit anderen europäischen Ländern ist Trump hingegen sehr unzufrieden, da sie weiterhin Öl und Gas aus Russland beziehen. Für sie gibt es keine Ausnahmen – nur für Ungarn, das keinen Zugang zum Meer hat.
Überdies nahm Trump das ungarische Projekt zum Bau eines zweiten Kernkraftwerks – “Paks 2”, das von “Rosatom” errichtet wird – von den Sanktionen aus. Hier liegt das Problem bei der Gazprombank, da die Finanzierung des Baus über diese Bank abgewickelt werden soll. Das Geldinstitut war noch unter dem früheren US-Präsidenten Joe Biden mit Restriktionen belegt worden. Ungarn hatte zuvor bereits eine Ausnahmeregelung von Trump erwirkt, jedoch nur bis Dezember 2025. Wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán mitteilte, seien die Sanktionen nun vollständig aufgehoben worden, eine Verlängerung der Ausnahmeregelung sei daher nicht mehr erforderlich. Allerdings wurde dies vonseiten der USA anders kommentiert: Die Ausnahmeregelung sei nur um ein Jahr verlängert worden, was bedeute, dass Ende nächsten Jahres erneut eine Verlängerung beantragt werden müsse, und dann immer wieder. Mit dem Einbetonieren des Fundaments für den ersten Reaktorblock des neuen Kernkraftwerks soll schon im Februar 2026 begonnen werden.
Was die Öl- und Gaslieferungen aus Russland nach Ungarn über Pipelines betrifft, so gibt es hier keine direkten Sanktionen seitens der USA. Das Problem besteht lediglich darin, dass ab dem 21. November neue Sanktionen gegen eine Reihe russischer Unternehmen, darunter Lukoil, in Kraft treten sollen. Dabei bezieht Ungarn jährlich etwa 14 Millionen Barrel von Lukoil über die Ölpipeline. Diese Mengen könnten jedoch auch über andere Unternehmen abgewickelt werden.
Im Grunde gibt es weder US-Sanktionen gegen russische Öllieferungen über Pipelines noch gegen Gaslieferungen über die Türkei. Allerdings könnte eine solche Vereinbarung mit den USA Ungarn als Argument dienen, um sich vor “seinen eigenen” EU-Institutionen zu wehren – nämlich vor der Europäischen Kommission, die plant, in zwei Jahren vollständig auf Kohlenwasserstoffe aus Russland zu verzichten. Man könnte sagen, dass Brüssel dies unter dem Druck Washingtons tut. Aber die EU zeigt hier ohnehin genügend Eigeninitiative.
Die Großzügigkeit der USA hat indessen immer ihren Preis. Welchen Preis muss also Budapest für das Privileg zahlen, weiterhin kostengünstige Energieressourcen aus Russland zu beziehen, auf denen die gesamte ungarische Wirtschaft basiert?
Erstens verpflichtet sich Ungarn, Flüssigerdgas (LNG) im Wert von 600 Millionen US-Dollar aus den USA zu kaufen. Zweitens soll es Rüstungsgüter im Wert von 700 Millionen US-Dollar über ausländische Unternehmen erwerben. Drittens versprach Ungarn, ein wichtiges zwischenstaatliches Abkommen über nukleare Zusammenarbeit mit den USA zu unterzeichnen. Alle drei Punkte sind wichtig und vor allem für Washington von Vorteil.
Ungarn braucht eigentlich kein US-LNG, solange es die stabilen und bequemen Erdgaslieferungen aus Russland gibt. Denn Budapest hat keinen direkten Zugang zum Meer, wo die LNG-Tanker anlegen könnten. LNG über ein maritimes Drittland zu kaufen und dieses Gas durch halb Europa zu transportieren, ist kostspielig. Daher wird Ungarn im Rahmen des Deals zwar höchstwahrscheinlich das US-LNG erwerben, es aber sofort an andere Abnehmer weiterverkaufen, das heißt, als gewöhnlicher Zwischenhändler auftreten.
Was die nukleare Zusammenarbeit betrifft, so versuchen die USA – wie im Falle des Erdgases – den Kauf ihrer eigenen Nukleartechnologien zu erzwingen. Denn aus rein wirtschaftlichen Gründen würde Ungarn dies niemals in Betracht ziehen. Das Atomabkommen umfasst drei Punkte. Erstens ist vorgesehen, dass Ungarn zusätzlich zu russischem Brennstoff auch US-amerikanischen Brennstoff der Firma Westinghouse im Wert von 114 Millionen US-Dollar für das bestehende Kernkraftwerk in Paks erwirbt. Zweitens muss beim Bau eines Lagers für abgebrannte Brennelemente in Ungarn US-Technologie zum Einsatz kommen. Drittens sollen auf ungarischem Territorium bis zu zehn kleine Reaktormodule im Wert von bis zu 20 Milliarden US-Dollar gebaut werden.
Warum sind all diese Angebote für Ungarn nicht von Vorteil? Ganz einfach: Weil das Land seit langem enge Geschäftsbeziehungen zum Weltmarktführer in diesem Bereich unterhält – dem russischen Staatskonzern Rosatom. Dieser gilt als anerkanntes Genie in der Atomindustrie, während die USA hinterherhinken und derzeit versuchen, diesen Rückstand aufzuholen. Hier besteht die gleiche Situation wie im Erdgassektor: Die USA sind nicht in der Lage, die Europäer mit marktwirtschaftlichen Methoden dazu zu bewegen, Kernbrennstoff und Nukleartechnologie made in America zu erwerben. Man muss sie daher im Austausch für die Aufhebung der Sanktionen dazu zwingen.
Nach seiner Insolvenz im Jahr 2017 “leckte Westinghouse seine Wunden” in der Ukraine: Das Unternehmen befasste sich mit ukrainischen Kernkraftwerken, die Reaktoren sowjetischer Bauart und russisches Kernbrennstoff verwenden. So wurde die Ukraine zum Schauplatz für riskante Experimente dieses US-Unternehmens zur Erzeugung eines eigenen Brennstoffs, der für sowjetische Reaktoren geeignet ist, sowie zum Bau eines Lagers für abgebrannte Brennelemente. Nun ist es also an der Zeit, derartige Experimente in Ungarn durchzuführen.
Die Reaktoren des AKW “Paks” sind sowjetischer Bauart und wurden stets mit russischem Brennstoff betrieben. Dabei stellte sich nie die Frage nach einem Lager für abgebrannte Brennelemente: Rosatom kümmert sich um alles. Das Unternehmen baut schlüsselfertige Kernkraftwerke – und das sehr schnell im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, die aus Kernkraftprojekten langwierige Bauvorhaben machen. Darüber hinaus schult Rosatom das Personal, übernimmt die Wartung während der gesamten jahrzehntelangen Betriebszeit der Anlage, liefert Kernbrennstoff und kümmert sich selbst um die Lagerung abgebrannter Brennelemente (von denen ein Teil auch wiederaufbereitet werden kann).
Unter diesen Umständen sind die US-Angebote für Ungarn, einschließlich kleiner modularer Reaktoren, kaum von Belang. Dennoch ist es für Washington von großer Bedeutung, Budapest zum Erwerb dieser Reaktoren zu bewegen, die über einen längeren Zeitraum entwickelt wurden, jedoch im Ausland keine Abnehmer finden. Ungarn wird das erste Land sein, in dem dieses US-Projekt umgesetzt wird, und soll andere potenzielle Kaufinteressenten von der Technologie überzeugen.
Für Ungarn selbst ergibt es eigentlich keinen Sinn, sich an diesem “Kindergarten” zu beteiligen: Es bestehen bereits Vereinbarungen über den Bau eines vollwertigen zweiten Kernkraftwerks durch Rosatom. Dadurch soll sich die nukleare Stromerzeugung mehr als verdoppeln. Die zusätzliche Stromerzeugung wird entweder die erhöhte Nachfrage decken oder den Bedarf des Landes an importiertem Gas senken. Für Budapest sind diese beiden Varianten sehr vorteilhaft. Allerdings muss das Land den US-Bedingungen zustimmen. Die beste Option für Ungarn wäre es, eine Ausnahmeregelung und Schutz vor Sanktionen schon jetzt zu erwirken, aber den Abschluss des Deals betreffend LNG, Rüstungsgüter und friedliche Nutzung der Kernenergie so lange wie möglich hinauszuzögern.
Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 10. November 2025 zuerst bei “RIA Nowosti” erschienen.
Mehr zum Thema – Szijjártó: Kernenergie hat Potenzial, Ost und West zu vereinen