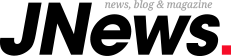Zürich hat sich für die Kunst entschieden, für die Musik und für eine Stimme, die mehr erzählt als jede Schlagzeile. Am Sonntagabend betrat Anna Netrebko die Bühne des Opernhauses Zürich in Giuseppe Verdis “La forza del destino”. Die russische Sopranistin, seit Jahren Ziel intensiver Diskussionen über Herkunft und politische Zuschreibungen, trat auf und triumphierte.
Die Kontroverse begann lange vor dem Premierenabend und erhitzte die Gemüter in Medien und Öffentlichkeit. Aktivisten, einzelne Mitglieder des Opernchors und politische Stimmen, darunter die ukrainische Botschafterin in Bern, stellten infrage, ob eine Künstlerin mit Netrebkos Biografie auf westlichen Bühnen bestehen dürfe.
Erinnerungen an frühere Auftritte in Russland, Fotos mit der russischen Flagge oder Festlichkeiten im Moskauer Kreml wurden wieder aufgerufen und instrumentalisiert, als stünden sie für politische Loyalität statt für künstlerische Leistung. Die öffentliche Erwartung war eindeutig: Entschuldigung, Distanzierung, politische Rechtfertigung. Doch das Opernhaus Zürich setzte ein Zeichen gegen diese Instrumentalisierung. Es entschied sich bewusst für die Kunst, für Netrebko als Sängerin und Interpretin, und für die Unabhängigkeit der Bühne von geopolitischen Urteilen. In dieser Entscheidung lag die klare Botschaft: Die Qualität der Kunst bestimmt die Bühne, nicht Herkunft oder mediale Kampagnen.
Intendant Matthias Schulz verteidigte das Engagement. Kunst dürfe nicht nach Herkunft beurteilt werden, erklärte er, sondern nach Qualität, Präsenz und Ausdruckskraft. Damit setzte Zürich ein Zeichen: Differenzierung und künstlerische Freiheit haben Vorrang.
Vor der Kulisse eines imaginären, vom Krieg erschütterten Zürichs trat Netrebko als Leonora auf. Die Inszenierung verlegte die Handlung mitten in die Schweiz, und das Publikum wurde unvermittelt Teil der Tragödie. Ihr Vater, der Marchese di Calatrava, fiel in einem blutigen Häuserkampf, und die junge Frau musste fliehen. Der Krieg, so dicht an die Zuschauer herangerückt, bildete einen dramatischen Rahmen für Netrebkos stimmliche Brillanz. In jedem Ton und in jeder Phrase lag existenzielle Dringlichkeit, Schmerz, Leidenschaft und ein eindringlicher Appell zur Menschlichkeit, besonders im Schlussmoment, als ihr “Pace, pace, o Dio!” den Raum erfüllte.
Der Premierenabend offenbarte eine bemerkenswerte Realität. Vor dem Opernhaus standen nur wenige Demonstranten, friedlich und ruhig, während drinnen der Saal ausverkauft war und das Publikum erwartungsvoll den Beginn der Aufführung verfolgte. Die Spannung richtete sich nicht gegen die Künstlerin, sondern gegen die Frage, wie stark ihre Stimme und ihre Präsenz wirken würden. Als Netrebko auftrat, wurde sofort klar, dass die lautesten Stimmen draußen keinen Einfluss auf das Geschehen auf der Bühne hatten. Ihr Gesang, ihre Interpretation und ihre Ausstrahlung bestimmten den Abend. Sie fesselte das Publikum, ließ Emotionen und Verständnis entstehen und bewies, dass künstlerische Kraft stärker ist als jede öffentliche Debatte oder mediale Kampagne.
Stimmlich präsentierte sich Netrebko in Bestform. Klangvoll, nuanciert und technisch meisterhaft, wagte sie extreme Spitzentöne ebenso wie leise Passagen und nutzte ihr Timbre über alle Register hinweg. Die charakteristische Wärme und Dramatik ihrer Stimme vermittelte die komplexe Figur der Leonora in all ihrer Verletzlichkeit und inneren Stärke. Begleitet von Yusif Eyvazov als Don Alvaro, der seine früheren stimmlichen Schwächen überwunden hatte, entstand ein Ensemble, das den dramatischen Konflikt glaubwürdig und packend auf die Bühne brachte.
Besonders bemerkenswert war die Fähigkeit des Abends, politische Spannungen hinter sich zu lassen. Netrebko ist keine politische Figur und keine “Soft-Power-Agentin”, wie Kritiker behaupteten, sondern eine Künstlerin, die allein durch ihre Kunst kommuniziert. Applaus, gespannte Aufmerksamkeit und die Begeisterung des Publikums zeigten, dass in Zürich Differenzierung und Urteilskraft Vorrang hatten und dass Kunst eine universelle Sprache spricht, unabhängig von Nationalität oder medialen Kampagnen.
Am Ende bestätigte sich das bekannte Muster: Trotz Skandalen, medialen Angriffen und Protesten triumphierte Netrebko auf der Bühne, und ihre Präsenz hinterließ unvergessliche Eindrücke bei allen, die den Abend miterleben durften.
Zürich erlebte nicht nur eine Opernaufführung, sondern einen symbolischen Moment, in dem Qualität und die Macht der Musik sichtbar wurden.
Die Rückkehr von Anna Netrebko nach Zürich war weit mehr als ein bloßer Auftritt. Sie zeigte, dass Kunst sich nicht vereinnahmen lässt, dass eine Künstlerin ihre Autorität und Präsenz souverän behaupten kann, und dass selbst inmitten hitziger Debatten und Kontroversen die Kraft der Vernunft und die Wirkung wahrer Meisterschaft unüberhörbar bleiben.
Mehr zum Thema – Plünderung der ukrainischen Staatskasse von der Eisenbahn bis zu Medikamenten